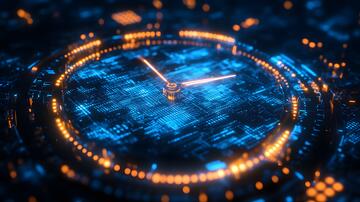Low Code – Aber richtig!

Auf dem Weg zur Befähigung der Fachbereiche und der IT
Mit der Einführung von Office 365 ist das Produktportfolio von Microsoft im Bereich der Office-Tools gewachsen. Darunter verbergen sich bei vielen Unternehmen unausgeschöpfte Schätze. So wie zahlreiche andere Unternehmen haben wir die Power Platform zunächst nicht beachtet, nachdem Office 365 eingeführt wurde. Erst später erkannten wir das Potenzial dieser Plattform und begannen, sie für unsere Zwecke einzusetzen. Im Folgenden wollen wir unseren Weg zur Nutzbarmachung der Power Platform teilen.
Power Platform: Kurzeinführung
Die Power Platform besteht aus fünf mächtigen Low-Code-Development-Modulen mittels derer sowohl Applikationen, Websites oder Reports entwickelt als auch Prozesse automatisiert werden können. Diese Entwicklungs-Tools sind in die Microsoft-Produktlandschaft stark integriert und stellen eine Menge an Konnektoren zur Verfügung. Power Apps ist ein komponentenbasiertes Framework zur einfachen Frontend-Entwicklung. Mittels Drag-and-drop, Anpassungen an Parametern der Komponenten und kleinen Formeln, die an Event-Handler gebunden werden, können Applikationen entwickelt werden.
Power Automate verfolgt einen ähnlichen Ansatz, zielt aber auf die Prozessautomatisierung ab. Mittels Komponenten zur Steuerung von Kontroll- und Datenfluss als auch Konnektoren lassen sich automatisierte Abläufe, sogenannte Flows, entwickeln.
Für eine konkrete Lösung ist häufig eine Kombination von Power Apps und Power Automate notwendig. Soll ein Frontend beispielsweise einen Dateiupload ausführen, wird dieser mit Power Automate ausgesteuert. Power Automate und Power Apps sind eng miteinander verzahnt. Beide Tools werden gemeinsam lizenziert und administriert.
Power BI erweitert das Portfolio als Werkzeug für die Erstellung von Berichten. Es verwendet einen komponentenbasierten Ansatz, um die Entwicklung zu beschleunigen. Power BI ist das älteste Werkzeug der Power Platform und hat eine gewisse Eigenständigkeit, zum Beispiel bei der Lizenzierung und der Verwaltung. Diese drei Produkte bilden den Kern der Power Platform und werden von Power Pages, einem Tool zur Erstellung von Webseiten, und Copilot Studio (ehemals Power Virtual Agents), einem Tool zum Aufbau eigener Chatbots, ergänzt.
Microsoft verfolgt drei Wege, um die Plattform an seine Kunden zu bringen. Neben einer direkten Lizenzierung wird die Plattform im Dynamics-365-Umfeld genutzt und kommt in einer abgespeckten Variante mit der Microsoft-365-Lizenzierung. Insbesondere über die Lizenzierung im M365-Umfeld haben viele Unternehmen bereits Zugriff auf diese Technologie, ohne sich bewusst für diese entschieden zu haben. Hier beginnt unsere Reise.
Low Code und Power Platform: Die Reise beginnt
Während unserer Einführung von Office 365 sind bereits einzelne Prozesse über die Power Platform automatisiert worden, welche aber noch nicht zu einer tieferen Beschäftigung geführt haben. Die Tools waren von allen Mitarbeitern nutzbar. Es dauerte daher nicht lange, bis an vielen Stellen erste Gehversuche starteten.
Der richtige Durchbruch der Power Platform kam jedoch in der Zeit der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020. Durch die von der Pandemie ausgelösten Beschränkungen im Arbeitsalltag kam es zu einer ganzen Reihe von Digitalisierungsideen, um sich diesen Änderungen schnellstmöglich anzupassen. Eine Idee war es, die auferlegte Kontaktnachverfolgung im Unternehmen in Form einer App zu realisieren. Das war im Mai 2020 und noch gab es keine entsprechenden Angebote auf dem Markt. Daher wurde eine solche App in Form einer Power App umgesetzt – dies innerhalb weniger Tage! Dabei zeigten sich die unkomplizierte Entwicklung und die schnelle Verteilung der App an alle Mitarbeiter des Unternehmens als große Vorteile.
Der Grundstein war gelegt. Ein motiviertes Team im Sinne einer Fokusgruppe wurde gegründet, um andere Low-Code-Plattformen kennenzulernen, mit der Power Platform zu vergleichen und einen Weg für das Unternehmen für Low Code zu ebnen. Das erste Ziel: Herausfinden, welche Einsatzgebiete sinnvoll sind, diese fördern und Wachstum nachweisen. Wenn Interesse und erste Erfolge sichtbar sind, wird der Betrieb ausgebaut.
Im ersten Jahr der Erprobung identifizierten wir drei Bereiche, in denen wir die Power Platform verstärkt einsetzen wollten:
- Citizen Development: Entwicklung durch die Fachbereiche
- Digitalisierungspflaster: Digitalisierung kleinerer Abläufe und Optimierung von Prozessen
- Kostengünstige Digitalisierungsinitiativen: Erprobung mittels der Power Platform und spätere Professionalisierung
Diese werden im Folgenden dargestellt.
Citizen Development: Befähigung der Mitarbeiter
Anbieter von Low-Code-Plattformen propagieren gerne, dass ihre Tools so einfach sind, dass Fachbereiche mit Hilfe dieser Software selbständig entwickeln können. Ähnliche Aussagen sind auch über die Power Platform zu finden. Wie bereits oben erwähnt, ist der Zugriff auf Power Apps und Power Automate mit der Einführung von Microsoft 365 für alle Kollegen aktiviert, sodass wir genau dies beobachten können. Das Interesse der Fachbereiche, sich mit diesen Tools auseinanderzusetzen, ist in jeder Hinsicht vorhanden.
Eine gewisse Grunderfahrung im Umgang mit Programmiersprachen ist dennoch sehr hilfreich, wenn nicht sogar erforderlich. Es werden Anlaufstellen benötigt, um Kollegen bei der Entwicklung zu unterstützen, aber auch Regeln, die klar aufzeigen, was erlaubt ist und was nicht.
Genau hier setzt unsere Befähigung der Mitarbeiter an. Wir erklären die Plattform, regen zum Ausprobieren an, geben Hinweise zur Verbesserung und haben einen Katalog mit klaren Regeln. Mit diesem grundsätzlichen Verständnis für den Aufbau und die Möglichkeiten gestalten Mitarbeiter selbst aktiv. Sie entwerfen individuelle Lösungen. Alte Prozesse werden hinterfragt, die jahrelang einfach durchgelaufen sind. Die Erkenntnis des "Ach, so einfach geht das!?" hat so manches Digitalisierungspotenzial ans Licht gebracht.
Dies bedeutet viel Kommunikation, was wir über verschiedene Kanäle schaffen. Hierzu haben wir eine Low-Code-Community aufgebaut, die sich um die Wissensvermittlung von Low-Code-Plattformen (wie der Power Platform) ins Unternehmen bemüht. Es werden intern organisierte Hands-On-Schulungen durchgeführt, an denen inzwischen bereits über 100 Mitarbeiter teilgenommen haben. Das sind in unserem Fall ca. sieben Prozent der Unternehmensbelegschaft. Darüber hinaus haben wir Zwischenschritte transparent gemacht und Erfolge gefeiert. Wann immer ein Flow einen alten Arbeitsablauf ablöste oder eine App eine robustere Eingabe ermöglichte, wurde dies kommuniziert, um zum Auszuprobieren anzuregen. Wir regen an, Lösungen zu teilen.
Um unsere errungenen Erkenntnisse über die Power Platform festzuhalten, haben wir einen Power-Platform-Guide ins Leben gerufen. Dadurch sollen sich Mitarbeiter eigenständig mithilfe eigens aufgenommener Tutorials, vorgefertigter Vorlagen und Sammlungen von Dokumentationen befähigen, selbst entwickeln zu können. Die Inhalte dieses Guides entstammen dabei der Community, wodurch ein breites Feld von fachspezifischen Themen abgedeckt wird. Das bedeutet: Jeder kann Inhalte beisteuern und den Guide besser machen.
Nun ist es so, dass nicht alle Mitarbeiter Low-Code-Entwickler werden – das sollen sie auch gar nicht. Es reicht, wenn gewisse Schlüsselfiguren in Abteilungen, diejenigen, die bspw. Prozesse überblicken, ein Verständnis für die Plattform haben. Entweder um selbst zu entwickeln oder zum Formulieren konkreter Anforderungen an die IT. Somit erhöhen wir das Tempo der Digitalisierung und verbessern bestehende Abläufe.
Föderierte Umgebungen und Community
Mitarbeiter brauchen eine Umgebung zum Spielen, Testen und Entwickeln, damit sie Erfolge mit der Power Platform erzielen können. Dies unterscheidet sich nicht von hauptberuflichen Entwicklern. Während Software-Entwickler das entsprechende Wissen haben, wofür Testumgebungen dienlich sind und wie diese aufgesetzt werden, fühlt sich dies für M365-Tools eher merkwürdig an. Dennoch ist es fundamental. Es wird eine Umgebung benötigt, in der wenig erfahrene Entwickler kleine Lösungen umsetzen können. Gleichzeitig sollen Anwendungen aber stabil betrieben werden. Um dies bewerkstelligen zu können, haben wir Umgebungen für verschiedene Zwecke definiert. Alle Mitarbeiter können bei uns Anwendungen mit der Power Platform entwickeln, haben aber nur Zugriff auf die Konnektoren im M365-Umfeld. Dies verhindert unter anderem den Abfluss von Daten. Key User haben die Möglichkeit, Zugriff auf andere Umgebungen zu erhalten, die erweiterte Rechte gewähren, um somit externe Systeme zu adressieren. Diese Benutzer müssen wissen, was sie tun und mit den Leitlinien der IT vertraut sein. Zum Schluss nutzen wir eine Reihe an Experten-Umgebungen, in denen Apps professionell entwickelt und betrieben werden. Bei Experten-Umgebungen wird überdies das Staging in Form verschiedener Umgebungsstufen mitberücksichtigt. Hier wird teilweise applikationsspezifisch getrennt, sodass Beeinflussungen von Tätigkeiten durch verschiedene Dienstleister verhindert werden können.
Für die einzelnen Umgebungen sind klare Regeln und Prozesse definiert, die wir mittels unseres Monitorings wieder überwachen. Zugegeben: Wir lernen und bauen weiter aus. Wir haben einen klaren Weg vor Augen.
Kommen wir zu den Schlagworten dieses Abschnitts. Sind Regeln und Prozesse erstmal gesetzt, ist eine moderierte, vernetzte Community unerlässlich. Erst mit dieser entfaltet die Power Platform ihr volles Potenzial. Wenn man es schafft, dass sich Mitarbeiter über Lösungsansätze unterhalten, fördert dies die Digitalisierung ungemein. Viel mehr noch: Neben den eigentlichen Apps entstehen ganze Initiativen.
Digitalisierungspflaster: Integration und Weiterverarbeitung mit der Power Platform
Die Power Platform ersetzt nicht die Software-Entwicklung. Werden Applikationen zu groß, empfinden wir die Wartung dieser Apps aufwändiger als den klassischen Ansatz. Die Plattform bietet aber einzigartige Möglichkeiten, kleine Helferlein zu entwickeln, die einfach zu teuer für eine normale Entwicklung wären. Gleichzeitig bietet sich die Plattform als Kleber zwischen großen, zentralen Systemen an. Auch Kleinigkeiten haben einen Einfluss auf das Unternehmen. Das Reparieren "kleiner Wunden" brachte uns dazu, kleine Applikationen "Digitalisierungspflaster" zu nennen.
Wie automatisch entsteht der Wunsch, die Power Platform mit anderen Applikationen zu integrieren. Schnittstellen und damit Datenflüsse entstehen, um mittels einfacher Workflows Daten zu migrieren oder für andere Anwendungen aufzubereiten. Mittels On-Premise-Gateways kann man diese Kommunikation etablieren. Spätestens hier ist darauf zu achten, Datenschutz und Security gut einzubinden, um Rahmenparameter zu klären. Hat man seine Hausaufgaben hinsichtlich APIs im Unternehmen und Datennutzung geregelt, mausert sich die Power Platform als Tool zur Selbstoptimierung. Wir sehen hier großes Potenzial. Unser Ansatz: Die Qualität und Stabilität der Kernsysteme sind unerlässlich. Schnittstellen und die Nutzung durch IT-Außenstehende dürfen den Betrieb nicht gefährden. Der Kreis schließt sich, da somit die Befähigung der Mitarbeiter und Regeln für die Nutzung der Platform wieder in den Fokus geraten.
Professionelle Entwicklung
Apps können sehr schnell komplex werden. Dies betrifft nicht nur die Weiterentwicklung und Wartung. Wir erlebten einzelne Fälle, in denen Fachbereiche ihre Apps nicht mehr weiterentwickeln konnten. Spätestens dann heißt es "professionalisieren". Entweder übernimmt die IT die App und entwickelt diese auf Basis der Power Platform weiter. Als Alternative lässt sie sich über klassische Ansätze neu entwickeln, was je nach Größe und angestrebter Roadmap durchaus sinnvoll ist.
Unser zentrales Monitoring hilft uns, Fakten zu schaffen. Wir messen die Komplexität der Anwendungen. Ist diese zu hoch, suchen wir das Gespräch. Dazu messen wir den Einsatz und die Verwendung von Konnektoren und damit Schnittstellen und Verbindungen. Wird eine Applikation eine Spinne im Netz, sind die Abhängigkeiten und Kritikalität für das Unternehmen zu werten.
Ähnliches gilt für die Anzahl der User, die Zugriff auf eine App haben. Wird die Anzahl zu groß, sollte man die App und die Kritikalität fürs Unternehmen hinterfragen.
Kostengünstige Digitalisierungsinitiativen
Schnelles Ausprobieren und Lernen
Innovation steht bei so gut wie jedem Unternehmen auf der Agenda. Mittels der Power Platform lässt sich dies aktiv fördern. Neben den Digitalisierungspflastern lassen sich Initiativen und Tests voranbringen. In unserem Haus ist die mobile Erfassung von Daten ein größeres Thema.
Die Power Platform bietet uns dort die Möglichkeit, verschiedene Szenarien mittels Prototypen zu testen, Ideen zu evaluieren und Wissen zu generieren, bevor wir professionalisierte Ansätze suchen. Klein anfangen, kostengünstig testen und erste Erfolge erzielen. Wenn sinnvoll, Neuentwicklung anstreben und fördern. Wir erreichen mittels dieses Ansatzes schnelle Feedback-Zyklen, die gerade im Innovationsbereich Anklang finden. Die Power Platform gehört dort zum Standard-Repertoire.
Kosten und Lizenzen
Eines der Hauptargumente für die Power Platform sind deren geringe Kosten, was mit Obacht zu betrachten ist. Entwicklung ist meistens günstig, der Betrieb kann schnell teuer werden. Ist der Anwendungsfall gut beschrieben, lassen sich die Kosten durchaus rechnen. Wichtig dabei ist es, die Projekt- und Betriebskosten zusammenzurechnen und die Gesamtkosten über die Lebensdauer der Software zu betrachten, um Verzerrungen zu minimieren. Je nach Lizenzierung schnellen die Kosten gerne in die Höhe.
Gerade für Projekte mit Unsicherheiten oder bei Tests sind Kosten und Lizenzierung besonders zu beachten. Ist die spätere Nutzeranzahl nicht bekannt und steigt diese im Betrieb rasant, steigen die Kosten mit. Versteckte Kosten, wie zusätzlicher Speicher für das Dataverse oder zusätzlich zu lizenzierende Konnektoren (Premium Connectors) lassen die ausgaben ebenfalls wachsen.
Dies soll aber nicht gegen die Power Platform sprechen, sondern darauf aufmerksam machen, dass die Plattform Konzepte und einen geregelten Betrieb benötigt. Gute Plattform-Governance und -Hygiene sind daher unerlässlich.
Power Platform: Lessons Learned
Wir sind die ersten Schritte zur Nutzbarmachung der Power Platform gegangen. Wir sind zufrieden und freuen uns auf weitere Erfolge. Zur Nutzbarmachung der Einsatzbereiche Citizen Development, Digitalisierungspflaster und kostengünstige Digitalisierungsinitiativen sind unsere Schlüsselthemen Befähigung der Mitarbeiter, föderierte Umgebungen und Community, Integration und Weiterverarbeitung, professionelle Entwicklung, schnelles Ausprobieren und Lernen, Kosten und Lizenzen.
Wir hoffen, dass der Einblick in unsere Reise für andere Power-Platform-Begeisterte interessant ist und hoffen, dass das Lesen des Artikels für den einen oder anderen Nutzer eine Anregung darstellt. Wir sind für jeden Erfahrungsaustausch zu haben.