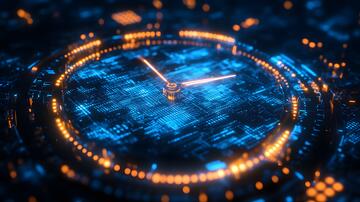Konflikte im Unternehmen lösen: So hilft das Harvard-Modell in der Praxis

Ob bei der Abstimmung zwischen Fachbereichen, der Auswahl einer neuen Softwarelösung oder der Organisation alltäglicher Arbeitsmittel – Konflikte gehören zum organisationalen Miteinander in Unternehmen. Entscheidend ist dabei weniger das Auftreten eines Konflikts, sondern die Art und Weise, wie mit ihm umgegangen wird.
Eine Methode, die sich besonders im betrieblichen Kontext bewährt hat, ist das Harvard-Prinzip. Ursprünglich aus der Verhandlungsführung stammend, lässt sich ihr Prinzip überraschend wirksam auf den Büroalltag übertragen – gerade dann, wenn die Diskussionen emotional, die Positionen verhärtet und die Interessen verborgen sind.
Das Harvard-Prinzip erklärt: Vom Positionskampf zur echten Verständigung
Konflikte eskalieren häufig deshalb, weil über Positionen gesprochen wird, ohne die dahinterliegenden Bedürfnisse und Interessen zu klären. Statt also in der Diskussion zu verharren, ob eine bestimmte Maßnahme "richtig" oder "falsch" ist, lädt die Harvard-Methode dazu ein, die Perspektive zu weiten:
Die vier zentralen Grundregeln des Harvard-Prinzips
- Trennung von Person und Problem
Konflikte sollten nicht personalisiert werden. Es gilt, in der Diskussion die Sachebene zu bewahren und gemeinsam nach Lösungen zu suchen – nicht nach Schuldigen. - Fokus auf Interessen statt Positionen
Hinter jeder Forderung steht ein Beweggrund, der sich häufig durch Emotionen ausdrückt. Wer diesen erkennt, kann von der Emotions- auf die Sachebene wechseln und tragfähige Lösungen entwickeln. - Entwicklung von Optionen zum gegenseitigen Vorteil
Anstelle von Nullsummenlogik wird ein Raum für Kreativität geschaffen. Das Ziel: Optionen, die für alle Seiten akzeptabel sind. - Verwendung objektiver Kriterien
Entscheidungen sollten nachvollziehbar und sachlich begründbar sein. Wenn KPIs hinzugezogen werden können, ist es für alle Beteiligten hilfreich.
Konfliktlösung mit dem Harvard-Prinzip: Ein Praxisbeispiel aus der Softwareentwicklung
Ein typisches Szenario:
- Das Entwicklungsteam drängt auf einen sicherheitskritischen Bugfix.
- Das Vertriebsteam benötigt zeitgleich eine Demo-Version für eine bevorstehende Messe.
Im ersten Anlauf eskaliert die Situation: Prioritäten werden infrage gestellt, gegenseitige Vorwürfe ausgesprochen, die Kommunikation wird hitzig. Durch den Einsatz der Harvard-Methode wird ein Perspektivwechsel möglich:
- Was genau soll die Demo-Version erreichen?
- Welche Anforderungen sind aus Kundensicht unverzichtbar?
- Gibt es Alternativen, die beide Ziele ermöglichen?
Ergebnis: Ein einfacher, interaktiver Prototyp wird als Zwischenlösung definiert, bei dem Look-&-Feel im Fokus steht, ohne die logische Anbindung im Hintergrund. Durch die verkürzte Entwicklungszeit kann der Bugfix im Vorfeld umgesetzt werden. Die Sicherheit bleibt gewährleistet, die Messe kann vorbereitet werden. Kein "Kompromiss", sondern ein gemeinsamer Lösungsraum.
Harvard-Methode in der Praxis: Strukturiertes Vorgehen in Konfliktgesprächen
Die Umsetzung der Harvard-Methode lässt sich in einem fünfstufigen Ablauf strukturieren, der sowohl für informelle Gespräche als auch für moderierte Verhandlungen geeignet ist:
- Zielklärung: Was genau soll besprochen oder entschieden werden?
- Position und Interessen darlegen: Jede Partei formuliert ihre Sichtweise und die dahinterliegenden Interessen – ohne Bewertung durch andere.
- Lösungsideen entwickeln: Ideen werden gesammelt, ohne sie sofort zu beurteilen.
- Optionen bewerten und Entscheidung treffen: Welche Option bringt den größten gemeinsamen Nutzen?
- To-dos festlegen und Follow-up organisieren: Wer übernimmt welche Aufgaben bis wann? Zusätzlich wird ein Termin für ein Follow-up festgelegt.
Harvard-Methode und die Beschaffung einer neuen Kaffeemaschine – Ein Beispiel aus der Praxis
Selbst alltägliche Themen lassen sich strukturiert verhandeln – etwa die Beschaffung einer neuen Kaffeemaschine:
- Geschäftsführung: möchte schnell und effizient eine funktionale Lösung finden.
- Betriebsrat: legt Wert auf gute Qualität und Beteiligung der Mitarbeitenden.
Mit der Harvard-Methode wird deutlich: Beide Seiten verfolgen dasselbe übergeordnete Ziel – zufriedene, leistungsfähige Mitarbeitende. Die Lösungsfindung kann somit auf Basis geteilter Interessen erfolgen.
Konfliktlösung im Team: Wie das Konfliktboard Klarheit und Struktur schafft
Konflikte zu moderieren und Lösungen zu entwickeln gelingt umso besser, wenn man komplexe Zusammenhänge sichtbar macht. Ein bewährtes Instrument dafür ist das sogenannte Konfliktboard – eine einfache, aber äußerst wirksame Strukturhilfe, die das Harvard-Prinzip greifbar macht und Teams durch einen klaren, schrittweisen Prozess führt.
Das Board, das sich an der obigen strukturierten Vorgehensweise orientiert, ist in mehrere Felder unterteilt:
- Ziel der Verhandlung: Hier wird präzise formuliert, worum es geht – und was gemeinsam erreicht werden soll. Diese Fokussierung hilft, Abschweifungen und Themen-Hopping zu vermeiden.
- Positionen und Interessen der Beteiligten : Jede Partei legt ihre Position auf sachlicher Ebene dar. Was treibt die Beteiligten an? Was sind die eigentlichen Bedürfnisse hinter den Positionen? Dieses Feld ist der Schlüssel zur Verständigung, denn oft zeigt sich hier mehr Gemeinsamkeit als zunächst angenommen. Wichtig: Es geht nicht um Rechtfertigung oder Bewertung, sondern um Sichtbarmachung.
- Lösungsideen : Nun werden Ideen gesammelt – frei, kreativ, ohne Bewertung. Das Ziel ist, möglichst viele Vorschläge zu entwickeln, die auf die erkannten Interessen einzahlen.
- Bewertung der Optionen und Entscheidung: Welche Vorschläge sind tragfähig? Welche erfüllen die Interessen beider Seiten am besten? Hier findet die gemeinsame Auswahl statt – idealerweise
im Sinne einer Win-Win-Lösung. Sollte es Bewertungskriterien geben, werden diese hinzugezogen.
To-dos & Follow-up: Zum Abschluss wird verbindlich festgehalten, wer was bis wann umsetzt – inklusive Termin für ein Follow-up.
Konfliktboard in der Praxis – So funktioniert die Anwendung im Teamalltag
Ein Konfliktboard kann auf einem Flipchart, Whiteboard oder digital (z. B. Miro, Mural, Conceptboard) gestaltet werden. Es dient sowohl als Moderationswerkzeug in Workshops als auch als Reflexionshilfe in bilateralen Gesprächen.
In der Anwendung zeigt sich: Das Board unterstützt nicht nur die Strukturierung der Diskussion, sondern sorgt auch für Transparenz, Verbindlichkeit und Nachvollziehbarkeit – gerade in Teams, die mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen und Fachlogiken arbeiten. Besonders hilfreich ist es in folgenden Situationen:
- Wenn Konflikte bereits spürbar sind, aber niemand sie konkret benennt.
- Wenn Sachfragen durch persönliche Spannungen überlagert werden.
- Wenn Entscheidungen immer wieder vertagt oder verwässert werden.
Durch das gemeinsame Arbeiten am Board entsteht ein gemeinsames Bild der Lage – und damit eine gemeinsame Basis für tragfähige Entscheidungen.
Die Vorteile des Harvard-Prinzips
Laut Einschätzung eines unserer Kunden im Rahmen eines Beratungsprojekts gehen rund 20 Prozent der Arbeitszeit durch unproduktive Konflikte verloren. Dies bedeutet nicht nur Effizienzverluste, sondern auch Reibungsverluste in der Zusammenarbeit und Motivationseinbußen.
Das Harvard-Prinzip bietet hier einen klar strukturierten Rahmen, der sowohl emotional aufgeladene Situationen deeskalieren als auch nachhaltig tragfähige Lösungen ermöglichen kann.
Fazit: Konfliktlösung als Führungs- und Teamkompetenz
In einer Arbeitswelt, die von Komplexität, wechselnden Anforderungen und interdisziplinären Teams geprägt ist, gewinnt die Fähigkeit zur konstruktiven Konfliktlösung zunehmend an Bedeutung.
Das Harvard-Prinzip stellt dafür ein ebenso bewährtes wie zugängliches Instrumentarium bereit – praxisnah, strukturiert und wirkungsvoll.