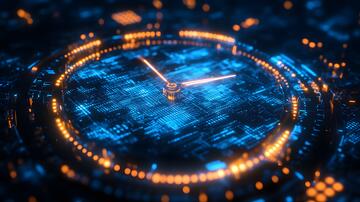KI-basierte Geschäftsmodelle für Startups: Chancen und Herausforderungen

Künstliche Intelligenz ist das prägendste Technologiethema unserer Zeit. Innerhalb kürzester Zeit hat sich insbesondere durch das Aufkommen von generativen KI-Funktionen die Art und Weise, wie digitale Geschäftsmodelle entstehen, skalieren und sich behaupten, fundamental verändert. Vor allem für Startups scheint KI ein verheißungsvolles Spielfeld: Nie zuvor war es mit so wenig Ressourcen möglich, so leistungsstarke Technologien in marktfähige Produkte zu überführen. Die großen Sprachmodelle sind dabei eine demokratisierende Technologie, die auch für kleine Unternehmen mit überschaubaren Kosten nutzbar sind. Die Folge: Absurd hohe Bewertungen für kleine Startups – das sogenannte "Tiny-Teams-Phänomen" [1].
Die Gründungsdynamik im Startup-Bereich durch Künstliche Intelligenz ist weltweit sehr hoch. Für Deutschland zählen die Expertinnen und Experten des AppliedAI Institute for Europe insgesamt 687 KI-basierte Gründungen und damit für 2024 einen Anstieg von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein Blick auf das investierte Wagniskapital in Deutschland zeigt, dass auch viele Investorinnen und Investoren an den Erfolg der KI-Startups glauben. Im Jahr 2024 wurde knapp eine Milliarde in KI- & Analytics-Startups investiert, die immer mehr auch mit der klassischen Welt der SaaS-Startups verschmelzen, weil diese zunehmend auch umfangreiche KI-Funktionen in ihre Software integrieren [2]. Insgesamt zeigt sich: Während andere Bereiche wie E-Commerce oder CleanTech sich aktuell schwer tun, bleibt KI ein stabiles Wachstumsfeld, das von Investorinnen und Investoren langfristig als zukunftsträchtig eingeschätzt wird.
Denn trotz der Innovationskraft und Agilität vieler junger Unternehmen stellt sich die Frage, ob KI wirklich ein Spielfeld für alle ist – oder ob sich am Ende doch wieder die globalen Tech-Giganten die lukrativsten Anwendungsfälle sichern. Vor allem Google und OpenAI liefern sich einen atemberaubenden Wettstreit um die besten Sprachmodelle und Anwendungsfälle. Meta hält mit sehr leistungsstarken Open-Source-Ansätzen dagegen. Was ist also, wenn die nächste Version eines Tech-Giganten das eigene Produkt überflüssig macht oder wenn GAFAM mit einem einzigen Update eine komplette Nische besetzen? Startups müssen naturgemäß diese Entwicklungen genau beobachten und können gleichzeitig die Risiken gezielt abmildern, indem sie ihre eigenen Geschäftsmodelle mit Bewusstsein für diese Entwicklungen gestalten.
Deutsche KI-Startups: Sieben typische Geschäftsmodell-Kategorien
Anhand einer Analyse von ca. 40 führenden KI-Startups in Deutschland können die Herausforderungen verdeutlicht werden. Basis dafür sind ein Ranking der Applied AI Initiative mit 27 vielversprechenden KI-Startups und eigene Recherchen des Digital Hub münsterLAND [3]. Insgesamt lassen sich die Startups dabei grob in sieben Kategorien einordnen.
- Customer Service und Conversational AI
Ein bedeutender Bereich für KI-Startups ist der Kundenservice für Conversational-AI-Lösungen. Diese ermöglichen die Automatisierung von Kundeninteraktionen über Telefon, Chat oder E-Mail. Viele Startups entwickeln Lösungen, die sich in bestehende Kommunikationskanäle wie CRM-Systeme oder Call-Center-Software integrieren lassen. Besonders vorteilhaft sind maßgeschneiderte Modelle für spezifische Branchen, die auf individuelle Kundenbedürfnisse eingehen können. Beispiele für solche Startups sind Cognigy und Parloa, die vor kurzem eine Bewertung von einer Milliarde Dollar erreichten [4]. - Autonome Systeme und Transport
Startups in diesem Segment konzentrieren sich auf die Automatisierung von Fahrzeugen und Logistikprozessen. Hierbei ist die Integration in bestehende Infrastrukturen, etwa in Logistikzentren, von entscheidender Bedeutung. Allerdings sind hohe Kapital- und Technologiehürden zu überwinden, da Investitionen in Hardware, Sensorik und Sicherheitssoftware notwendig sind. Beispielhaft können hier die Startups Fernride und Kopernikus Automotive genannt werden. - Satelliten- und Geospatial Intelligence
Bei Startups im Bereich der Satelliten- und Geodaten-Analyse geht es um den Einsatz von Satellitenbildern zur Überwachung von Umweltbedingungen, Infrastruktur oder geologischen Prozessen. Startups wie constellr oder LiveEO entwickeln Lösungen zur Analyse großer Mengen an Sensordaten und ermöglichen so neue Anwendungen in Bereichen wie Klimaforschung oder Katastrophenprävention. Eine Herausforderung ist der Zugang zu Satellitendaten, der oft mit hohen Kosten und regulatorischen Anforderungen verbunden ist. Nicht zufällig gibt es auch hier einen Wettstreit der Tech-Giganten (vor allem Elon Musk und Jeff Bezos) im Weltraum [5]. - Industrielle Automatisierung, Fertigung und Design
KI-Startups wie Spread und Synera im Bereich der industriellen Automatisierung unterstützen die Konstruktion, Überwachung und Optimierung von Maschinen, Anlagen und Produktionsketten. Oft ist domänenspezifisches Wissen erforderlich, um maßgeschneiderte Lösungen für bestimmte Industrien zu entwickeln. Dabei muss auch die Abhängigkeit von und Integration in Hardware-Komponenten gelöst werden. Aufgrund der Bedeutung der Industrie für den Standort Deutschland ist die Integration von KI-Funktionen in bestehende Prozesse ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche Zukunft des Landes. - Enterprise-Lösungen und Business Process Outsourcing (BPO)
Ein großer Teil der deutschen KI-Startup-Szene konzentriert sich auf datenbasierte Prozess- und Entscheidungsunterstützung für Unternehmen, die branchenübergreifend einsetzbar sind. Diese Lösungen werden häufig als Software as a Service (SaaS) angeboten und lassen sich in bestehende IT-Umgebungen integrieren. Besonders in Bereichen wie Finanzwesen (z. B. Buynomics), Personalmanagement (z. B. edyoucated) oder Lieferkettenoptimierung (z. B. Tacto) bieten KI-gestützte Lösungen erhebliche Effizienzsteigerungen. - KI-Entwicklung, Large Language Models (LLMs) und Governance
Nicht nur Tech-Giganten, sondern auch Startups forcieren die Entwicklung oder das Training von KI-Systemen, insbesondere Large Language Models (LLMs) und komplexe neuronale Netze. Darunter das vielleicht bekannteste deutsche KI-Startup Aleph Alpha. Andere Startups arbeiten an der Entwicklung von Sprachmodellen innerhalb eines spezifischen Anwendungskontextes (z. B. DeepL). Darüber hinaus bieten Startup-Unternehmen wie Langdock Middleware-Lösungen zur Verwaltung von KI-Modellen oder entwickeln spezielle Ansätze zur DSGVO-konformen Nutzung von KI-Technologien. - Spezialisierte Domänenanwendungen
Schließlich gibt es eine Reihe von KI-Startups, die hochspezialisierte Anwendungen für bestimmte Branchen entwickeln. Dies betrifft vor allem regulierte Sektoren wie das Gesundheitswesen (z. B. Floy), Bau- und Planungsrecht (z. B. syte) oder militärische Anwendungen (z. B. Helsing), in denen die enge Zusammenarbeit mit Experten und Forschungseinrichtungen erforderlich ist. Die Anwendungen lassen sich dann auch meistens nicht ohne Weiteres auf andere Sektoren übertragen.
Disruptionsgefahr für Gruppen von KI-Startups
Der Wettbewerb innovativer Startups gegen marktbeherrschende Plattformen ist kein neues Phänomen, das erst mit dem Aufstieg der KI begonnen hat – im Gegenteil: Schon in früheren Wellen digitaler Geschäftsmodelle hat sich gezeigt, dass es immer wieder Startups gelingt, selbst anscheinend uneinnehmbare Bastionen der Tech-Giganten zu durchbrechen. So können sich beispielsweise E-Commerce-Anbieter wie Office Partner oder Thomann in Bereichen behaupten, die auf den ersten Blick fest in der Hand von Amazon schienen. Ihr Erfolgsrezept: Spezialisierung, exzellenter Kundenservice und tiefes Produktverständnis – alles Stellschrauben, an denen auch KI-Startups drehen können. Auch im Social-Media-Bereich war lange Zeit kaum vorstellbar, dass jemand neben Facebook und Instagram noch eine nennenswerte Rolle spielen könnte – bis TikTok mit einem völlig neuen Content-Ansatz und klarem Fokus auf Creator-Engagement zur weltweit führenden Plattform aufstieg.
Diese Beispiele zeigen: Selbst gegen anscheinend übermächtige Wettbewerber können Geschäftsmodelle erfolgreich bestehen. Um die Gefahren und Chancen zu bewerten, helfen diese in Anlehnung an die von Thales S. Teixeira 2020 formulierten Fragen [6]:
- Was sind die großen Stärken der Plattformen, die hauptsächlich für deren Erfolg verantwortlich sind?
- Kann mein Geschäftsmodell ein Angebot (Nische, Kundensegment) identifizieren, deren Adressierung durch die oben genannten Stärken erschwert wird?
- Würde die Nachahmung des eigenen Angebots dem Hauptgeschäft der großen Plattform irgendwie schaden?
Die großen Anbieter von KI-Sprachmodellen wie OpenAI und Google verfügen natürlich über erhebliche Stärken. Dazu zählen massive Rechenkapazitäten und Zugriff auf riesige Mengen an Trainingsdaten, die es ihnen ermöglichen, besonders leistungsfähige Modelle zu entwickeln. Durch die Integration ihrer KI-Funktionalitäten in bestehende Produkte erreichen sie Millionen Nutzer ohne zusätzliche Vertriebskosten. Gleichzeitig schaffen sie durch APIs und Entwicklungsumgebungen eigene Ökosysteme, die Entwickler binden und Innovation zentralisieren. Dennoch lassen sich in Bezug auf die oben genannte Kategorisierung von KI-Startups unterschiedliche Disruptionsgefahren anführen:
| Gruppe | Disruptionsgefahr | Erklärung |
| Customer Service und Conversational AI | hoch | Große Anbieter können Conversational-AI-Funktionen unkompliziert in ihre bestehenden Kommunikations- und CRM-Systeme einbetten, ohne ihr Kerngeschäft zu verändern. |
| Autonome Systeme und Transport | mittel | Obwohl autonome Systeme spezielle Hardware und Zertifizierungen erfordern, haben große Tech-Firmen oft bereits entsprechende Ressourcen und Partnerschaften, sodass eine Integration möglich ist, ohne signifikante strategische Anpassungen. |
| Satelliten- und Geospatial Intelligence | hoch | Tech-Giganten besitzen häufig Zugang zu umfangreichen Geodaten und können entsprechende Analysefunktionen in ihre Plattformen integrieren, ohne ihre Kernkompetenzen zu vernachlässigen. |
| Industrielle Automatisierung, Fertigung und Design | gering | Diese Nischenlösungen beruhen auf tiefem branchenspezifischem Know-how und engen Kundenbeziehungen. Ein großer Konzern müsste weit von seinen etablierten Kerngeschäften abweichen, um vergleichbare Angebote zu entwickeln. |
| Enterprise-Lösungen und Business Process Optimization | mittel | Auch wenn diese Lösungen für bestimmte Business-Funktionen (z. B. Einkauf, Compliance, HR, Lieferketten) maßgeschneidert sind, operieren viele Tech-Konzerne bereits im B2B-Bereich. Ihre bestehenden Plattformen erlauben oft eine Integration solcher Funktionen, wenn auch mit Anpassungen, sodass das Risiko hoch, aber nicht extrem (also nicht "sehr hoch") ist. |
| KI-Entwicklung, Large Language Models und Governance | hoch | Große Tech-Unternehmen verfügen über umfangreiche F&E-Kapazitäten und moderne Infrastrukturen. So können sie fortlaufend innovative KI-Funktionen entwickeln und in ihre Produkte integrieren, ohne wesentliche strategische Kompromisse eingehen zu müssen. |
| Spezialisierte Domänenanwendungen | gering | Nischenlösungen erfordern spezifisches Fachwissen und oft regulatorische Anpassungen. Hier wäre der Eintritt großer Konzerne mit strategischen Kompromissen verbunden, wodurch das Risiko moderat bleibt. |
KI-Startups vs. Tech-Giganten: Wie KI-Startups die Wettbewerbsfähigkeit gelingt
Die Konkurrenz durch große Tech-Plattformen gehört zum Alltag vieler KI-Startups – mal schleichend, mal abrupt. Gleichzeitig sind die großen Plattformen der Enabler für Startups überhaupt breit erfolgreich sein zu können. Ein Spannungsfeld, das es abzuwägen gilt. Je nach Risikograd lassen sich unterschiedliche Strategien ableiten, um im Rennen mit den Großen bestmöglich vorbereitet zu sein.
- Bei hoher Disruptionsgefahr
Wenn das Geschäftsmodell leicht kopiert werden kann oder sich auf vorhandene Sprachmodelle und Cloud-Infrastrukturen stützt, wird es am ehesten brenzlig. In solchen Fällen hilft vor allem, sich möglichst auf vielfältige Weise abzuheben. Eine Spezialisierung auf Nischenmärkte, die für große Plattformen unattraktiv oder schwer erreichbar sind, kann zum entscheidenden Vorteil werden. Proprietäre Technologien, Zugriff auf exklusive Daten und eine agile Produktentwicklung schaffen zusätzlichen Schutz. Wer schnell wächst, clever skaliert und sich im Markt sichtbar macht, kann außerdem zum interessanten Kaufkandidaten für größere Player werden – eine schnelle Wachstumsstrategie mit Exit-Option kann zum Masterplan werden. - Bei mittlerer Disruptionsgefahr
Ist die Gefahr spürbar, geht es darum, das eigene Geschäftsmodell ständig widerstandsfähiger zu machen. Hier zählt vor allem das kontinuierliche Weiterentwickeln des Angebots und die Festigung der bestehenden Kundenzugänge. Starke Beziehungen zu Kunden – etwa durch individuellen Service, regionale Verankerung und tiefe Integration in Kundensysteme – schaffen echte Wechselbarrieren. Dazu gehört zwangsläufig auch eine enge Beobachtung des KI-Marktes, um frühzeitig Trends zu erkennen und das Geschäftsmodell weiter daran anzupassen. Auch Partnerschaften mit etablierten Unternehmen können die eigene Position stärken und bringen zusätzliches Know-how und Reichweite ins Spiel. - Bei geringer Disruptionsgefahr
In spezialisierten Märkten mit hohen Einstiegshürden ist die Ausgangslage vergleichsweise komfortabel. Es gilt hier seinen Vorsprung zu nutzen, um über klare Positionierung, kontinuierliche Innovation und gezielte Kooperationen eine stabile Führungsrolle aufzubauen. Die Expansion in angrenzende Märkte, das Heben neuer Anwendungsfälle oder der Aufbau eines Partnernetzwerks sorgen dafür, dass man nicht nur vorne bleibt, sondern den Abstand zu möglichen Nachahmern sogar noch vergrößert.
Künstliche Intelligenz auf den diesjährigen IT-Tagen
Spannende Vorträge und Workshops zum Thema Künstliche Intelligenz erwarten Euch auch auf den IT-Tagen, der Jahreskonferenz von Informatik Aktuell. Die IT-Konferenz findet jedes Jahr im Dezember in Frankfurt statt – dieses Jahr vom 08.-11.12.
Fazit: Die Chancen für Europa und Deutschland überwiegen
Unabhängig von der konkreten Disruptionsgefahr gilt wenig überraschend: Je präziser ein KI-Startup ein konkretes Problem löst – schneller, spezifischer, datengetriebener und näher an den tatsächlichen Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden – desto schwerer fällt es selbst großen Plattformen, dieses Angebot einfach zu imitieren oder zu verdrängen. Das sind gerade für ein Hochtechnologieland wie Deutschland gute Neuigkeiten, denn es ergeben sich beispielsweise dort besondere Chancen, wo technologische Innovation auf industrielle Kompetenz trifft. Während Deutschland in der ersten Welle der Digitalisierung (z. B. Social Media, B2C-Plattformen) hinterherhinkte, zeigt sich im Bereich der KI-Anwendungen schon jetzt ein anderes Bild. Industrielle Anwendungen und B2B-Nischenlösungen bieten enormes Potenzial, weil sie auf spezifischem Fachwissen, tiefem Prozessverständnis und engen Kundenbeziehungen beruhen – alles Faktoren, in denen der deutsche Mittelstand traditionell sehr stark ist.
Gleichzeitig sinken die Einstiegshürden für die Entwicklung technischer Lösungen dank verfügbarer Basismodelle und Open-Source-KI rapide. Auch die Betriebskosten eines KI-Software-Startups fallen in Europa deutlich geringer aus als im Vergleich zu den USA. Hinzu kommen gut ausgebildete Fachkräfte, zahlreiche Forschungsinstitutionen und eine wachsende Anzahl an Investorinnen und Investoren, die sich gezielt für europäische und verantwortungsvoll entwickelte KI interessieren. Regulierung, wie etwa der EU AI Act, wird dabei insbesondere von Startups nicht als Bremse, sondern als Chance verstanden, planbare, robuste und vertrauenswürdige Produkte zu entwickeln.
Europa und Deutschland haben somit nicht nur die Gelegenheit, bei der Entwicklung KI-basierter Geschäftsmodelle mitzuspielen – sondern gerade an der Schnittstelle von KI, Industrie und Mittelstand auch die Chance, eine führende Rolle einzunehmen. Und genau darin liegt die Antwort auf die Titelfrage des Artikels: Künstliche Intelligenz ist eine Revolution – auch und gerade für deutsche Startups. Wer sich dort positioniert, wo pure Größe auch zum Nachteil werden kann, schafft sich nachhaltige Geschäftschancen im Schatten der Tech-Giganten.
Dieser Artikel basiert auf einem Vortrag des Autors im Rahmen des NAVIGATE-Onlinekongresses. Ein Video des Vortrags ist auf YouTube verfügbar.