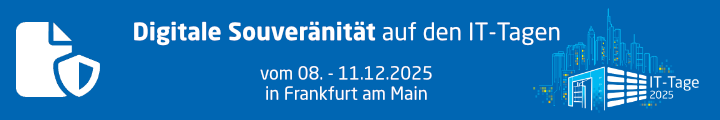Investitionen in digitale Souveränität
Open Source als Schlüssel zu digitaler Souveränität und wirksamen Digital-Investitionen

Deutschlands Behörden- und Verwaltungslandschaft muss dringend digitaler werden. Das ist keine Frage der Bequemlichkeit, wie Versprechen vom "Behördengang vom Sofa aus" suggerieren. Eine digitale Verwaltung ist längst der Indikator für moderne staatliche Leistungsfähigkeit und somit ein entscheidender Standortfaktor für die Wirtschaft.
Spätestens seit dem zweiten Amtsantritt Trumps ist ein zweiter Faktor hinzugekommen: Deutschland muss nicht irgendwie digitaler werden, es muss auch digital souverän werden. Soll heißen: Der demokratische Staat darf sich nicht länger von einzelnen Anbietern abhängig machen, die mit hochintegrierten Softwarewelten große wirtschaftliche Macht ausüben und ihre Kunden in die selbstverschuldete Abhängigkeit führen können. Angesichts der aktuellen weltpolitischen Entwicklungen gilt: Wir müssen raus aus der IT-Abhängigkeitsfalle. Staatliche digitale Dienste müssen sicher, unabhängig und transparent sein.
Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD spricht hier eine recht deutliche Sprache: "Unsere Digitalpolitik ist ausgerichtet auf Souveränität, Innovation und gesellschaftlichen Fortschritt. Digitalpolitik ist Machtpolitik. Wir wollen ein digital souveränes Deutschland.", heißt es dort gleich zu Beginn des Kapitels "Digitales". Der Weg zur informationstechnischen Unabhängigkeit setzt eines voraus: Ein klares Bekenntnis zu freier, quelloffener Software und ihr bevorzugter Einsatz in der öffentlichen Verwaltung. Denn nur mit Open Source kann digitale Souveränität nachhaltig gesichert werden.
Im europäischen Vergleich zeigt sich, dass in puncto digitaler Verwaltung für Deutschland noch viel Luft nach oben ist. Die Bundesrepublik belegte beim letzten eGovernment Benchmark der EU-Kommission 2024 den 23. Platz unter 27 verglichenen EU-Mitgliedsstaaten [1]. An Ambition mangelt es nicht: Seit im Jahr 2000 von der damaligen Bundesregierung das Programm "BundOnline" aufgelegt wurde, gehören ehrgeizige Zielsetzungen zum guten Ton der Politik. Bis 2005 sollten damals zahlreiche Leistungen der Bundesverwaltung digitalisiert werden. Es folgten unter anderem "Deutschland-Online", "Onlinezugangsgesetz" und "Onlinezugangsänderungsgesetz", stets mit ähnlichen anspruchsvollen Zielsetzungen. Aktuell sind bis zu knapp 300 der 595 im Onlinezugangsgesetz vorgesehenen Behördendienstleistungen digital verfügbar, abhängig davon, ob man in NRW (196 flächendeckend verfügbare Leistungen) oder in Hamburg (292 Leistungen) wohnt [2]. Deutschland wird also durchaus digitaler – aber es ist alles andere als ein Vorreiter der digitalen Verwaltung.
Die Gründe dafür sind wie immer vielfältig. Die komplexe Verteilung von Aufgaben im Föderalismus zwischen Bund, Ländern und Kommunen; die zersplitterte IT-Landschaft über Ebenen und Behörden-Silos hinweg; rechtliche Hemmnisse wie Schriftformerfordernisse oder gewachsene, hochkomplexe Prüf- und Nachweisanforderungen in Gesetzen und Verordnungen. Und nicht zuletzt wird immer wieder benannt: Digitalisierung kostet Geld, mitunter viel Geld, wenn sie umfassend angepackt wird. Wenn keine ausreichende Finanzierung vorhanden ist, entsteht Flickwerk statt durchdachter Ende-zu-Ende-Digitalisierung.
Hier erhellt aktuell ein Silberstreif den digitalpolitischen Horizont: das vom Bundestag jüngst beschlossene 500 Milliarden Euro schwere Infrastruktur-Sondervermögen. Grund zum Aufhorchen in Digitalisierungskreisen bieten hier mehrere Details: In der Begründung des Sondervermögengesetzes werden Herausforderungen in der Digitalisierung als einer der Faktoren genannt, die das Sondervermögen unausweichlich machen. Auch der Gesetzestext selbst zählt Digitalisierungsaufgaben zu den Infrastrukturinvestitionen, für die das frische Geld ausgegeben werden darf. Außerdem sollen die Bundesländer, in denen oftmals großer digitaler Aufholbedarf besteht, 100 Milliarden Euro vom Sondervermögen abrufen können.
Vieles spricht dafür, dass das Sondervermögen einen signifikanten Schub für dringend benötigte Projekte der digitalen Verwaltung ermöglicht. Aber: Mit Geld allein ist es nicht getan. Damit das Geld effektiv investiert werden kann und nicht verpufft, müssen zum einen die oben benannten weiteren Hindernisse angepackt werden, die die Digitalisierung der deutschen Verwaltung schon seit Jahrzehnten hemmen. Es braucht eine bessere, stringentere Digitalisierungs-Governance und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Zum anderen gilt es, die Zeichen der Zeit zu beachten: Fragen der digitalen Souveränität müssen bei Investitionsentscheidungen an vorderster Stelle mitgedacht werden. Das Geld darf nicht ausgegeben werden, um bestehende Abhängigkeiten von einzelnen Softwareanbietern zu zementieren und zu vergrößern. Vielmehr muss es in nachhaltige Digital-Investitionen fließen, die dauerhafte Werte schaffen, Deutschlands digitale Unabhängigkeit stärken und mehr Transparenz und Flexibilität in die Verwaltungs-IT bringen. Der Digital-Branchenverband Bitkom fasst dies in seinem Positionspapier zum Sondervermögen passend in zwei Kriterien zusammen: Die mit dem Sondervermögen finanzierten Digitalprojekte müssen "investiv" und "souverän" sein [3].
Digitale Souveränität stärken: Investive Ausgaben für dauerhafte digitale Werte
Im Kontext öffentlicher Ausgaben unterscheidet man zwischen "konsumtiv" und "investiv". Während Gelder für konsumtive Ausgaben im jeweiligen aktuellen Haushaltsjahr aufgebraucht werden, sind investive Ausgaben mit langfristigem Hintergrund geplant. Sie sollen also langfristigen Nutzen schaffen – denkt man wirtschaftlich, sollen sie Werte aufbauen und bestenfalls einen "Return on Investment" liefern, einfach gesagt: sich lohnen. Bei den enormen Summen, die für das schuldenfinanzierte Infrastruktur-Sondervermögen eingeplant sind, ist klar: Solche Geldmengen sollten in keinem Fall verpuffen, sondern müssen wichtige Grundlagen für Wohlstand und Sicherheit in der Zukunft legen. Vor allem, wenn man daran denkt, dass die Investitionen idealerweise dabei helfen sollen, die für sie aufgenommenen Schulden in Zukunft inklusive Zinsen zurückzahlen zu können.
Dass eine neue Brücke, die ein Industriegebiet erschließt oder der Ausbau einer Hochschule, die mehr Fachkräfte ausbildet, dazu beitragen, die Wirtschaftsleistung Deutschlands und damit das Steueraufkommen zu stärken, liegt auf der Hand. Aber wie verhält es sich bei immateriellen Gütern wie Software und staatsnahen Ausgabenfeldern wie der Verwaltungsdigitalisierung?
Auch hier gelten die gleichen Grundlagen: Investitionen sollen langfristig wirken, nachhaltig Werte schaffen und idealerweise dazu beitragen, die Wirtschaft zu stärken, um Steuereinnahmen zur Rückzahlung von Schulden zu generieren. Der Unterschied ist: Software ist, anders als eine Brücke, an Lizenzbedingungen geknüpft. Hier ist von der Politik Sachverstand gefordert, um sicherzustellen, dass digitale Investitionen sich langfristig lohnen. Denn je nach Lizenzmodell sind die Voraussetzungen unterschiedlich:
Proprietäre Lizenzen: Bei klassischen Lizenzmodellen erwirbt die Verwaltung ein Nutzungsrecht an gekaufter Software, kein eigentliches Eigentum daran. Obwohl die Kosten meist einmalig oder für eine bestimmte Zeitperiode anfallen, bleibt die Verwaltung vom Herstellenden abhängig: Für Updates, Support und Weiterentwicklungen fallen regelmäßig weitere Kosten an. Hier liegt also nur ein bedingt investiver Charakter vor – die Verwaltung kann nicht frei entscheiden, was mit der von ihr beschafften Software passiert, sondern ist an die Bedingungen aus dem Lizenzvertrag und den Anbieter gebunden.
Software-as-a-Service (SaaS) und Abonnement-Modelle sind eine Unterform der proprietären Lizenzen, Anbieter berechnen hier regelmäßige Nutzungsgebühren statt einmalige. Auch hier findet kein Vermögensaufbau statt, die Software ist quasi gemietet. Diese Modelle sind definitionsgemäß konsumtiv – es handelt sich um laufende Betriebskosten, die immer wieder anfallen. Wird nicht mehr regelmäßig gezahlt, fallen die Software und ihr Nutzen weg. Die Abhängigkeit vom Herstellenden ist noch größer, da dieser jederzeit Preise ändern oder Funktionen anpassen kann und oft über eng verknüpfte Cloud-Dienste auch die Kontrolle über verarbeitete Daten hat.
Software unter Open-Source-Lizenzen hat dagegen mehrere Vorteile: Auch hier entsteht zwar kein Eigentum in dem Sinne wie bei einer Brücke. Denn unter freien Lizenzen kann jeder die Software kostenlos nutzen und anpassen. Aber der Staat profitiert davon, dass die Nutzungsrechte weitgehend unbegrenzt sind. Lizenzkosten fallen nicht an, sondern nur Kosten für Anpassungen, Integrationen oder Weiterentwicklungen. Weder beim initialen Aufbau von Diensten noch beim fortlaufenden Support ist man an einzelne Anbieter gebunden. Betrieb und Entwicklung können durch verschiedene Anbieter erfolgen und somit sind Lock-in-Effekte, vor allem in Zusammenhang mit Cloud-Diensten, minimiert. Einmal entwickelte Funktionen können von anderen Behörden nachgenutzt werden und in der Verwaltung entsteht im besten Falle eigenes Knowhow, da Systeme in Eigenregie gewartet und weiterentwickelt werden können. Das führt sowohl zu effizienter Mittelverwendung als auch zu wesentlich größeren Freiheitsgraden für eine flexible und bürgergerechte digitale Verwaltung. Mit der öffentlich einsehbaren und frei nachnutzbaren Codebasis und dem Betrieb von Diensten unter eigener Kontrolle der Verwaltung entstehen hier echte immaterielle und langfristige Vermögenswerte als Gemeingut, die durch die Weiterentwickelbarkeit der Software langfristig Nutzen entfalten.
Unter dem Gesichtspunkt, dass (hohe) Investitionen in Deutschlands digitale Transformation nachhaltig Wirkung entfalten sollten, empfiehlt es sich also, auf Open-Source-Software zu setzen.
Darüber hinaus ergeben sich indirekte positive Effekte: Neue Entwicklungen im Rahmen staatlich beauftragter Software, Bug Fixes, geschlossene Sicherheitslücken und Anpassungen fließen zurück in Open-Source-Projekte und schaffen so weiteres Gemeingut, das von allen, auch außerhalb der Verwaltung genutzt werden kann. Unternehmen, Zivilgesellschaft und Privatleute profitieren von durch staatliche Investitionen gestärkten Open-Source-Ökosystemen. Open-Source-Technologien stecken heute in fast allen proprietären Softwareprodukten und erfüllen teils integrale Funktionen. Wenn der Staat konsequent auf Open Source setzt, steigert er also auch die Leistungsfähigkeit, Verlässlichkeit und Sicherheit der gesamten digitalen Infrastruktur.
Außerdem ergeben sich Effekte für die IT-Wirtschaft. In Europa sitzen zahlreiche auf Open Source spezialisierte IT-Dienstleister. Investiert der Staat in Open Source, stärkt er auch die deutsche und europäische IT-Wirtschaft. Das ist zum einen strategisch sinnvoll, zum anderen volkswirtschaftlich vorteilhaft: So kam eine Studie im Auftrag der EU-Kommission zu dem Schluss, dass 10% mehr Produktivität im Open-Source-Sektor zu einer EU-weiten Steigerung des Wirtschaftswachstums um 0,4 bis 0,6 Prozent sowie der Gründung von bis zu 600 neuen Startups in dem Bereich führen können [4].
Unabhängige digitale Infrastruktur: Digitale Souveränität als Gebot der Stunde
Unter dem Eindruck globaler Spannungen und seismografischer Verschiebungen in der internationalen Allianzbildung wird digitale Souveränität zum zentralen digitalpolitischen Prinzip: Der Staat darf sich digital – ganz wie in anderen Bereichen, die für seine Kernfunktionen unabdingbar sind – nicht in Abhängigkeit von einzelnen Akteuren begeben, seien sie staatlich oder wirtschaftlich. Er muss in der Lage sein, selbst Kontrolle auszuüben und Entscheidungen frei zu treffen. Teilbereiche sind hier die technologische Souveränität, also die Kontrolle über eingesetzte Hard- und Software-Technologien, sowie Datensouveränität, also die Kontrolle über erhobene und verarbeitete Daten.
In diesem Kontext lohnt es sich, genauer zu beleuchten, welche Ziele das Infrastruktur-Sondervermögen verfolgt: In der Begründung zum Gesetz wird die Notwendigkeit der Investitionen vorrangig mit der Reaktions- und Verteidigungsfähigkeit im Krisenfall begründet. Dem Kriterium der digitalen Souveränität fällt dabei eine große Bedeutung zu: Die digitale Infrastruktur des Staates muss so gestaltet sein, dass sie nicht von äußeren Akteuren abhängig ist oder sich der Staat im schlimmsten Fall erpressbar macht mit der Funktionsfähigkeit seiner digitalen Systeme.
Besonders hier kann Open-Source-Software ihre Stärken ausspielen, und zwar gleich in mehreren Dimensionen:
Open-Source-Software stärkt die Transparenz. Durch offenen Code kann klar nachvollzogen werden, wie Systeme funktionieren, was mit Daten funktioniert und wohin sie fließen.
Durch die Unabhängigkeit von einzelnen Herstellern und Betreibern wird echte Souveränität erst möglich. Nebenden oben beschriebenen wirtschaftlichen Vorteilen macht sich der Staat nicht abhängig von im Ausland sitzenden Softwareanbietern oder Cloudbetreibern, sondern kann Dienste auf europäischem Boden mit europäischem Know-how betreiben.
- Durch freie Anpassbarkeit der Software kann kurzfristig auf Erfordernisse im Krisenfall reagiert werden.
- Open-Source-Software ist außerdem langfristig verfügbar. Einzelne Anbieter können die Entwicklung oder den Vertrieb ihrer Software einstellen, was mit hohen Kosten oder sogar Ausfällen für Anwender in Behörden verbunden wäre. Open-Source-Software kann dagegen nicht einfach wieder vom Markt genommen werden, da sie für alle frei verfügbar ist.
Nicht nur aus staatlicher Sicht bringt Open-Source-Software im Behördeneinsatz enorme Vorteile. Auch die zivilgesellschaftliche Kontrolle staatlichen Handelns wird gestärkt, wenn anhand freien Codes nachvollzogen werden kann, welche Software genutzt wird, was sie tut und was mit Daten von Bürgern und Unternehmen geschieht. Dies kann helfen, die tief verwurzelten Vorbehalte gegen digitales Verwaltungshandeln abzubauen, die in großen Teilen der Bevölkerung noch existieren und die ein weiterer bremsender Faktor für eine erfolgreiche Digitalisierung sind.
Am Ende kann Open-Source-Software effektiv helfen, ein unabhängiges, flexibles, interoperables, erweiterbares, leistungsstarkes und transparentes staatliches Ökosystem digitaler Dienste aufzubauen – und damit auch das Vertrauen von Bürgern in die Leistungsfähigkeit von Staat und Demokratie stärken.
Von der Theorie in die Praxis: Mehr Open Source in deutschen Behörden
Also: Wie kann der Umstieg auf bzw. der Ausbau von Open-Source-Software in der öffentlichen Verwaltung gelingen? Es gibt bereits gute Ansätze. Am eindrücklichsten ist sicher das als GmbH dem Bundesinnenministerium nachgeordnete Zentrum für Digitale Souveränität in der öffentlichen Verwaltung (ZenDiS), das bereits Open-Source-Produkte im großflächigen Produktiveinsatz hat, wie beispielsweise die Office Suite openDesk mit 70.000 Nutzenden in der öffentlichen Verwaltung oder die ebenfalls bundeseigene Sovereign Tech Agency, die Projekte der Open-Source-Infrastruktur aktiv fördert.
Doch hier muss mehr geschehen, wenn wir es ernst meinen! Denn von den 16,6 Milliarden Euro Bundesmitteln, die im vergangenen Jahr in die digitale Verwaltung geflossen sind, kam nur ein Bruchteil Open-Source-Projekten als nachhaltige Investition zugute – der Großteil wurde für Lizenzzahlungen, Schulungen und Supportpakete von proprietären Softwareanbietern verbraucht.
Das Infrastruktur-Sondervermögen kann ein entscheidender Schritt in Richtung nachhaltig wirksamer Digitalisierung und digitaler Souveränität sein. Ob nun 10 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen in die Digitalisierung fließen, wie von der Bitkom vorgeschlagen oder doch ein anderer Betrag – wichtig ist, dass die Investitionen in Projekte fließen, die wirklich investiv und digital souverän sind. Dafür muss in der Umsetzung konsequent auf Open Source gesetzt werden. Um Open Source in der öffentlichen Verwaltung zu stärken, braucht es außerdem den politischen Willen, konkrete Hebel in Bewegung zu setzen.
Für eine wirksame Stärkung von Open Source im Behördeneinsatz mache ich deshalb sechs konkrete Vorschläge:
Ein Vorrang für Open Source in Vergabeverfahren der öffentlichen Hand mit begründeten Ausnahmen sowie Anpassungen in den Vergaberegeln, damit die mittelfristigen und strategischen Vorteile von Open-Source-Lösungen Berücksichtigung finden können, statt zuvorderst das auf den ersten Blick günstigste Angebot. So kann der Staat zum Ankerkunden werden, Open-Source-Ökosysteme stärken und selbst von den enormen Vorteilen von Open-Source-Software profitieren.
Ein Open-Source-Pflichtanteil für die öffentliche Beschaffung: So können Gelder gezielt gesteuert werden und auch bei Einzelfallentscheidungen für oder gegen freie Software immer das übergeordnete Ziel einer Stärkung der digitalen Souveränität im Blick behalten werden.
Eine Umlage für den Einsatz von proprietärer Software: Sollte in Vergabeverfahren doch geschlossene Software zum Zuge kommen, sollte für die Anbieter eine Abgabe fällig werden, mit der wiederum die Open-Source-Infrastruktur strategisch gestärkt werden kann.
Mit Geldern aus der Umlage sollten vor allem das ZenDiS und die Sovereign Tech Agency zusätzliche personelle und finanzielle Mittel erhalten, um Open Source in der öffentlichen Verwaltung von innen zu stärken. Denkbar wären auch umlagefinanzierte Förderprogramme für Open-Source-Projekte auf den verschiedenen föderalen Ebenen.
Ein Mehrwertsteuerrabatt auf Dienstleistungen rund um Entwicklung, Anpassung, Wartung und Betrieb von Open-Source-Lösungen kann zusätzlich die Open-Source-Industrie stärken. Zum anderen können Mittel effektiver eingesetzt werden, wenn ein geringerer Betrag über die Mehrwertsteuer in allgemeine Töpfe abfließt.
Eine gestärkte Open Source Governance in Form eines Open Source Project Office – zu dem sich beispielsweise das ZenDiS entwickeln könnte: Hier könnten Open-Source-Projekte kompetent gesteuert und unterstützt werden und staatliche Akteure aller Ebenen zum Einsatz von Open-Source-Software beraten werden.
Digitlae Souveränität auf den diesjährigen IT-Tagen
Spannende Vorträge und Workshops zum Thema Digitlae Souveränität erwarten Euch auch auf den IT-Tagen, der Jahreskonferenz von Informatik Aktuell. Die IT-Konferenz findet jedes Jahr im Dezember in Frankfurt statt – dieses Jahr vom 08.-11.12.
Fazit
Mit dem Sondervermögen bietet sich eine große Chance. Für echte Sprünge in der digitalen Verwaltung bei gleichzeitiger Stärkung der digitalen Souveränität kommt es nun auf drei Dinge an: digitalpolitischen Sachverstand, politischen Willen und – vielleicht am wichtigsten – Mut zum Machen! Mit einem klaren Bekenntnis zu Open Source wird vieles möglich.