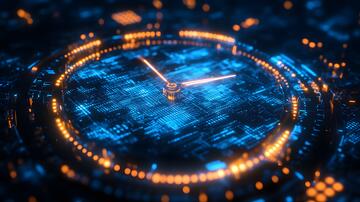Die Ungleichung lernender Organisationen
Wie schaffen wir es, dass eine Organisation lernt und resilient wird?

Unsere Berufswelt ist voller Paradoxien und Widersprüche. Beispiel gefällig? Einerseits bildet Wissen für uns Wissensarbeiter:innen die Basis unserer Arbeit. Andererseits veraltet Wissen im IT-Umfeld so schnell wie wohl kaum in einer anderen Branche. Und die Probleme mit unserem Wissen gehen weiter. Dass wir etwas wissen, bedeutet leider noch lange nicht, dass wir es auch in der Praxis umsetzen können. Vor dem Hintergrund der Umfelder unserer Organisationen, die VUCA oder sogar BANI sind (s. Kasten), potenziert sich der Bedarf, flexibel, anpassungsfähig und resilient zu sein.
Unsere Fähigkeit, auf verschiedenen Ebenen zu lernen, Wissen gezielt zu vermitteln und Wissensmanagement zu betreiben, ist der Schlüssel, Lösungen für diese Herausforderungen zu finden und auch in Zukunft erfolgreich am Markt zu sein. Sie erhöht unsere Anpassungsfähigkeit als Organisation an veränderte Rahmenbedingungen sowie unsere Innovationskraft. Wir lernen, unsere Effizienz sinnvoll zu steigern und verbessern unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Und nicht zuletzt: Wir erhöhen die Motivation unserer Mitarbeitenden!
Werfen wir einen Blick darauf, was es bedeutet, eine lernende Organisation zu sein und wie uns das hilft, mit komplexen Problemen fertig zu werden. Fangen wir mit unseren Betrachtungen vorne an…
VUCA und BANI kurz erklärt
Das Akronym VUCA ist aus den Anfangsbuchstaben der folgenden Begriffe zusammengesetzt und beschreibt eine volatile, unsichere, komplexe und mehrdeutige Umgebung:
- Volatility (Volatilität): bedeutet schnelle, unvorhersehbare Veränderungen ohne klares Muster oder Trend.
- Uncertainty (Unsicherheit): heißt Mangel an Vorhersehbarkeit – selbst mit vorhandenen Informationen ist die Zukunft schwer abschätzbar.
- Complexity (Komplexität): Viele miteinander vernetzte Faktoren erschweren die Entscheidungsfindung – Ursache und Wirkung sind schwer zu trennen.
- Ambiguity (Mehrdeutigkeit): Situationen oder Informationen lassen sich unterschiedlich interpretieren – es fehlt an Klarheit und Eindeutigkeit.
Das Akronym BANI beschreibt ein noch extremeres Umfeld:
- Brittle (brüchig): Systeme oder Strukturen wirken stabil, können aber plötzlich zerbrechen.
- Anxious (ängstlich): Dauerhafte Unsicherheit führt zu Angst, Stress und Überforderung.
- Nonlinear (nicht-linear): Ursachen und Wirkungen stehen in keinem klaren Verhältnis mehr – kleine Ereignisse können große Auswirkungen haben.
- Incomprehensible (unverständlich): Die Welt erscheint zunehmend undurchschaubar, selbst mit viel Information.
Bei VUCA steht der Umgang mit Komplexität und der resultierenden Unsicherheit im Fokus. Der Umgang damit geht primär in Richtung Strategie und Führung. Bei BANI geht es stärker um Fragilität und die emotionalen Reaktionen darauf. Der Umgang damit zielt daher mehr auf Resilienz und Anpassungsfähigkeit.
Was ist Lernen?
Lernen ist ein Prozess, der zu relativ stabilen Veränderungen im Verhalten oder im Verhaltenspotenzial führt und auf Erfahrung aufbaut [1]. Dabei scheint informelles Lernen, also das Lernen im Arbeitsprozess und im sozialen Umfeld, wichtiger zu sein als institutionelles Lernen in Schule, Universitäten usw. [2].
Lernen ist also ein psychologischer Vorgang, der in Menschen erfolgt. Das macht auch die Kontrolle von Lernerfolgen so schwierig. Wir können die Auswirkungen des Lernens, also den Lernerfolg, nur aus den angepassten Handlungen der Person erschließen. Macht die Person etwas, weil sie davon überzeugt ist, oder um meine Erwartungen als beobachtende und evtl. auch bewertende Person zu erfüllen? Wir werden es nie wirklich wissen.
Ein weiterer Aspekt ist beim Lernen essenziell: Neues Wissen wird über Erfahrung gewonnen und dockt an unserem bisherigen Wissen bzw. unseren vorher gelernten Strukturen an. Lernen ist ein Prozess, bei dem Wissen durch die Transformation von Erfahrung gewonnen wird [3]. Dabei kommen nach Jean Piaget zwei elementare Prozesse zum Tragen: Assimilation und Akkommodation. Lernen erfolgt dabei durch die Integration neuer Informationen in bestehende kognitive Schemata (Assimilation) oder durch die Veränderung dieser Schemata (Akkommodation), wenn diese nicht mehr passend sind. Bei der Assimilation werden die Informationen so verändert, also passend gemacht, dass sie sich in die bestehenden Schemata einfügen. Bei der Akkommodation werden die Schemata so verändert, dass sie entweder bezüglich der neuen Information angemessen sind oder nicht im Widerspruch zu anderen Schemata stehen [1].
Als Folge daraus darf ein Lernprozess nur eher kleine Schritte machen und muss sich auf die bestehende Erfahrung der lernenden Personen beziehen, damit Assimilation und Akkommodation greifen. Zu große inhaltliche Sprünge scheinen für uns dann nicht mehr erfassbar und docken nicht an dem Bestand unserer existierenden Schemata an. Lernen ist also ein Prozess und Wissen ist das Resultat eines Lernprozesses. Was ist nun Wissen genau?
Daten, Informationen und Wissen
Reine Daten haben für sich genommen keinen Wert, da sie noch keine Information ausmachen. Erst durch den Kontext, in dem die Daten betrachtet werden, und die Konsequenzen, also die Veränderungen, die sich daraus ergeben, wird aus Daten eine Information. Die Zahlenkette 13091975 kann alles Mögliche bedeuten, wie z. B. ein Geburtsdatum oder eine Bestellnummer. Wenn es sich um die Bestellnummer einer Reklamation handelt (Kontext) und dadurch ein entsprechender Prozess bei einem Versandhändler in Gang gesetzt wird (Veränderung), liegt eine Information vor. Bei einer Veränderung oder Konsequenz kann es sich ganz allgemein auch um die Veränderung einer Einstellung oder Bewertung handeln [4].
Wissen entsteht nun durch einen Denkprozess, in dem subjektive Informationen miteinander verknüpft und damit interpretiert werden. Ikujiro Nonaka und Hirotaka Takeuchi unterscheiden Wissen von Information über drei Aspekte [5]:
- Wissen ist mit Vorstellungen und Engagement verknüpft, da bei der Interpretation die Einstellungen, Perspektiven und Absichten der Person von Bedeutung sind.
- Wissen ist zweckgerichtet. Es geht bei Wissen daher stets auch um eine Handlung oder innere Einstellung der Person.
- Wissen ist kontext- und beziehungsspezifisch und hat damit immer auch eine Bedeutung für die Person.
In Bezug auf unseren Kontext hat Wissen noch einen weiteren wichtigen Aspekt: Es kann implizit oder explizit vorliegen. Implizites Wissen ist subjektiv. Es ist Erfahrungswissen, wie z. B. handwerkliches Geschick oder andere Fertigkeiten und an eine Person geknüpft. Es ist analoges Wissen, das sich im Handeln und in der Praxis zeigt. Explizites Wissen ist objektiv. Es ist Verstandeswissen, also theoretischer Natur und damit kommunizierbar. Es ist digitales Wissen, das eine kontextfreie Theorie entstehen lässt [5].
Wissen vermitteln
Wie können wir Wissen vermitteln? Je nachdem, welche der vier möglichen Kombinationen aus implizitem und explizitem Wissen vorliegt, gibt es eine konkrete Vorgehensweise (s. Abb. 1) [4,5]:
- Sozialisation: ist ein rein impliziter Wissensaustausch als Erfahrungsaustausch. Sozialisation kann sogar ohne Sprachen nur durch den unmittelbaren Kontakt über Beobachtung, Nachmachen oder gemeinsame Praxis wie Pair Working bzw. Üben erfolgen. Ohne den gemeinsamen Erfahrungskontext bleibt der Informationstransfer meist sinnlos.
- Externalisierung: Hier erfolgt das Explizitmachen von implizitem Wissen. Über Metaphern, Modelle, Analogien oder Hypothesen kann implizites Wissen in Sprache transferiert und kommuniziert werden. Ein Beispiel aus unserem Umfeld ist das Storytelling.
- Kombination: Verschiedene explizite Konzepte werden erfasst und verschiedene Bereiche expliziten Wissens miteinander verknüpft. Dabei kann es auch zu echten Innovationen kommen.
- Internalisierung: Über Learning by Doing mit ausreichend Wiederholungen entsteht die Übernahme von explizitem Wissen in implizites Wissen.
Was ist Können?
Mit dem impliziten Wissen sind wir bereits nah dran an dem, was als Können bezeichnet wird. Wenn wir etwas können, besitzen wir die Fähigkeit, Veränderungen herbeizuführen, durch die etwas Neues geschaffen wird. Können hat also eine praktische Natur. Das bedeutet ähnlich wie beim impliziten Wissen, dass Können vom Machen kommt [4,6].
Warum ist die Unterscheidung zwischen Wissen und Können in unserem beruflichen Umfeld von so großer Relevanz? Die Transformation von Wissen zu Können braucht Zeit! Zeit, die wir in unserer hochdynamischen Welt oft nicht haben. Wir möchten schnell reagieren können. Vielleicht nicht von heute auf morgen, jedoch schnell genug. Hier kommen die Lernprozesse zum Tragen. Haben wir das Lernen im Team gut genug gelernt? Ansonsten sind wir gezwungen, unter Zeitdruck einen bedarfsgetriebenen Lernprozess aufzusetzen. Wir buchen Trainings – oder holen wir uns Berater ins Haus?
Grundsätzliche Entscheidungen müssen zu Beginn getroffen und ein geeigneter Prozess definiert werden. Das dauert seine Zeit und zu schnell rennt uns diese davon. Und auch unsere Mitbewerber ziehen uns davon, während wir noch überlegen, wie wir uns "aufschlauen".
Lernprozess in Organisationen
Damit wir schnell handlungsfähig sind, greifen wir in den Teams und auch größeren Teilen einer Organisation darauf zurück, dass wir es als Gruppe gelernt haben zu lernen. Parallele Lernprozesse begleiten unsere Arbeit. So wie wir für unsere körperliche Gesundheit sorgen und zweimal pro Woche ins Fitness-Studio gehen oder täglich mit dem Rad zur Arbeit fahren, verfestigen wir unsere Flexibilität und Lernfähigkeit durch regelmäßige, unsere Arbeit begleitende Lernprozesse.
Lernen und die damit verbundenen Anpassungsprozesse sind in dynamikrobusten Organisationen ein permanenter, parallel zum Tagesgeschäft und den Projekten laufender Prozess – ein Trainingslager für die Köpfe und die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. So erhöhen wir die Reaktionsgeschwindigkeit einer Organisation und sind bereits auf der Höhe der Zeit bzw. nah dran.
Die begleitenden Lernprozesse stehen nicht im luftleeren Raum, sondern widmen sich Themen, die für unsere aktuelle oder zukünftige Arbeit vermutlich von Bedeutung sind. Wir probieren alternative Vorgehensweisen oder Programmiersprachen aus oder testen neue Werkzeuge in unserem Arbeitskontext. Vielleicht entwickeln wir auch ein eigenes Werkzeug, das ein ganz bestimmtes Problem für uns löst. Nicht selten entstehen aus solchen Ideen neue Produkte. Es kann auch sein, dass eine neue Idee von außen, z. B. aus Konferenzen oder Büchern aufgegriffen wird und versucht wird, diese in den eigenen Arbeitskontext abzubilden. Wichtig ist die Abbildung, weniger das Thema selbst.
Nach dem, was wir bereits über den Prozess des Lernens weiter oben festgehalten haben, ist ein Lernprozess ein iterativer Prozess, der in kleinen Schritten (Inkrementen) erfolgt (Abb. 2). Meine Darstellung eines solchen Prozesses ist auf der Experiential-Learning-Theorie von David Kolb aufgebaut [3].
Der Einstieg in einen Lernzyklus erfolgt stets über den Sinn (Abb. 2, Mitte rechts). Warum ist das Thema für mich bzw. jede einzelne Person wichtig? Es gilt, die Bedeutung für jede einzelne Person herauszuarbeiten. Dann werden die detaillierten Schritte des anstehenden Veränderungszyklus für die beabsichtigte Veränderung geplant. Als erstes gilt es, das Thema zu analysieren und die tiefen Zusammenhänge zu begreifen. Danach wird entschieden, was konkret gemacht werden soll. Jetzt beginnt das Experimentieren, in dem typischerweise die bisherigen Fertigkeiten ausgebaut und erweitert werden. Auf Basis der dabei gemachten Erfahrungen kann dann das Neue verstanden werden. Als letzter Schritt erfolgt eine Projektion in die Zukunft und wir erkunden, wohin uns die neuen Erkenntnisse alles führen können. Danach kann der nächste Zyklus darauf aufbauend begonnen werden.
Die Lerngruppe wird in dem Prozess durch vier Rollen unterstützt. Fachexpertinnen und -experten werden zu Beginn hinzugezogen, um das Thema systematisch darzustellen, z. B. durch Trainingsblöcke oder Texte. Meist sind es externe Expertinnen und Experten, die temporär hinzugezogen werden. In größeren Organisationen kann hier auch aus einer Abteilung, die bereits fundierte Erfahrungen mit dem Thema gemacht hat, eine entsprechende Unterstützung erfolgen.
Die Gutachterrolle hilft dabei, diesen Wissensstand auf die Realität der Organisation und ihre Ziele abzubilden. Dafür trifft sie Entscheidungen und strukturiert die Lernerfolgsbewertung. Bei lauffähiger Software sind das z. B. Prototyp- oder Produktkriterien, die im Review geprüft werden können. Um das Management in den Lernprozess aktiv einzubinden und eine wirksame Abbildung der Themen auf die Ziele der Organisation zu erreichen, ist es sinnvoll, dass die Gutachterrolle durch eine(n) Manager:in eingenommen wird. So erfolgt die Einbindung des Managements in die Lernprozesse.
Ein agiler Coach begleitet und unterstützt die Gruppe im Sammeln der Erfahrungen und im Experimentieren. Ggf. kann dieselbe Person auch die abschließende Bewertung und Auswahl der Folgethemen moderierend begleiten. Diese beiden Rollen sind sehr gut durch interne Kolleginnen und Kollegen wie Scrum Master oder Agile Coaches zu besetzen.
Wird in der Entwicklung inkrementell-iterativ vorgegangen, z. B. nach Scrum, dann können die Zyklen des Lernprozesses sehr gut auf die Entwicklungszyklen abgestimmt werden. Meist passen ein oder zwei Entwicklungszyklen gut zu einem Lernzyklus.
Wie spielen Theorie und Praxis zusammen?
Bevor wir uns anschauen, was noch notwendig ist, um eine lernende Organisation zu entwickeln, möchte ich kurz innehalten und mit etwas Abstand auf den Lernprozess blicken. Über einen wichtigen Aspekt haben wir noch nicht gesprochen.
Der skizzierte Lernprozess verbindet Theorie und Praxis. Die beiden Ausgangspunkte sind dabei stets die aktuelle Praxis und die Ziele, die wir erreichen wollen. Bekommen wir beides nicht in Deckung, erfolgt ein Lernprozess, um die Praxis an die Ziele anzupassen oder unsere Ziele besser zu konkretisieren. Meist erfolgt beides.
Um das Wissen austauschen und weitergeben zu können, wird es explizit gemacht. Dies erfolgt durch die Bildung oder Anpassung der theoretischen Grundlagen. Die Theorie bzw. Änderungen an der Theorie haben also in unserem Kontext stets einen praktischen Auslöser. Die Theorie soll uns in der praktischen Umsetzung unterstützen und muss deshalb zu der Praxis in einer Organisation passen. So weit, so gut.
Doch wie wählen wir unter den schier unendlichen Möglichkeiten des Machbaren die Themen aus, die wir umsetzen wollen? Es ist offensichtlich, dass wir nicht alles, was machbar ist, auch tun sollten. Zum Teil liegt es an gesetzlichen Rahmenbedingungen. Doch bei weitem nicht alles ist gesetzlich geregelt. Hier kommen Ethik und unsere Werte ins Spiel. Der gesamte Lernprozess läuft vor dem Hintergrund bzw. im Rahmen unserer Werte, Moral und ethischen Vorstellungen (Abb. 3).
Auch zwischen diesen beiden Ebenen – Theorie und Praxis zum einen und Moral und Ethik zum anderen – finden gegenseitige Beeinflussungen statt. Unsere Werte und ethischen Vorstellungen ändern sich über die Zeit, jedoch deutlich langsamer als die Wirkungen unserer Lernprozesse.
Lernende Organisationen und das Management von Wissen
So, die Bausteine sind vorhanden. Wie sieht nun eine lernende Organisation aus? Wenn wir schnell reagieren und innovativ sein wollen, kostet uns das kontinuierlich zu leistenden Aufwand. Dieser Aufwand ist für jeden Mitarbeitenden pauschal zu blocken.
Häufig wird Wissensmanagement auf ein paar Strukturen im Wiki reduziert. Damit ist dann bereits der Grundstein für die gescheiterte Einführung eines Wissensmanagements gelegt. Mit viel Elan angelegte Seiten veralten schnell und verlieren ihren Wert. Informationen brauchen Pflege, damit sie als Informationen wertvoll bleiben und nicht nur noch dokumentieren, was sich jemand früher einmal ausgedacht hat. Wissensmanagement ist ein komplexer Prozess, der dauerhaft und nachhaltig gelebt wird (Abb. 4).
Im Kern stehen die vier Prozesse der Wissensvermittlung. Der innere Prozess beginnt mit der Sozialisation, bei der implizites Wissen geteilt wird (Abb. 4, links). Indem wir daraus Konzepte entwickeln, externalisieren wir das implizite Wissen, können es dann mit anderem Wissen kombinieren und als Erneuerung kommunizieren bzw. transferieren (Abb. 4, Mitte und rechts).
Wissensmanagement darf jedoch nicht bei diesem inneren Prozess stehenbleiben. Unser explizites Wissen wird über unsere Produkte, Dienstleistungen, Marketing, Patente, Veröffentlichungen usw. in den Markt transferiert. Die Anwender:innen dort setzen sich damit auseinander und wenden das neue bzw. modifizierte Wissen an. Dabei wird es wieder internalisiert.
Jetzt kommt der entscheidende Schritt, der aus dem häufigen Vorgang des Transfers von Wissen (Abb. 4, unten rechts) das Management von Wissen macht: Das implizite Wissen der Anwender:innen aus dem externen Markt fließt wieder zurück in die Organisation (Abb. 4, links unten). Dies geschieht durch Sozialisation des Wissens, indem wir z. B. bei Anwenderinnen und Anwendern hospitieren oder uns auf Messen oder Konferenzen intensiv austauschen. So versuchen wir, mehr über den Markt zu erfahren, um unsere eigenen Schlüsse im Prozess des Wissensmanagements ziehen zu können. Innovation durch Kombination ist die logische Konsequenz daraus.
Wie macht uns das resilient?
Unser Wissen regelmäßig zu hinterfragen und veraltetes Wissen durch aktuelle Fakten zu ersetzen, ist der zentrale Baustein, um eine dynamikrobuste, resiliente Organisation aufzubauen. Das Wissen selbst ist dabei nur ein Aspekt. Der Prozess des Lernens und das Lernen lernen in Gruppen macht uns schnell und flexibel im Umgang mit dem neuen Wissen und den aktuellen Herausforderungen.
Daneben gibt es noch weitere Aspekte, die dazu beitragen, wie z. B.:
- Job-Rotation, insbesondere für das mittlere Management alle zwei bis vier Jahre: Wir verlieren dadurch etwas fachliche Tiefe, die jedoch meist besser bei entsprechenden fachlichen Expertinnen und Experten angelegt sein sollte. Und wir gewinnen sowohl einen guten Gesamtüberblick über die Prozesse und Wertschöpfung im Unternehmen als auch eine die Grenzen überschreitende Vernetzung der Mitarbeitenden.
- Grundsätzliche Regeln, die Innovation und Lernen fördern, wie sie z. B. für 3M veröffentlicht worden sind: Der New Product Vitality Index besagt dort, dass 35 Prozent des Umsatzes mit Produkten erwirtschaftet werden muss, die nicht älter als vier oder fünf Jahre sind. Gleichzeitig stehen 15 Prozent der Arbeitszeit der Mitarbeitenden für eigene Experimente und Ideen zur freien Verfügung [4].
- Vergleichbare Karrierestufen für Führungskräfte, Managerrollen und Expertinnen und Experten, damit sich jede Person nach ihren Stärken und Bedürfnissen einbringen und ausgebildet sowie gefördert werden kann.
- Eine Personalabteilung, die sich als Personalentwicklung versteht, die Lernprozesse fördert und einfordert und sich nicht auf die Personalverwaltung reduziert. Einer solchen Personalentwicklung können dann auch die team- und abteilungsübergreifend arbeitenden agilen Coaches und Moderatorinnen und Moderatoren zugeordnet sein.
Das sind Aspekte, die zusammenwirken und eine Organisation schnell reaktionsfähig machen. So wird auch der Rahmen dafür geschaffen, selbst innovativ zu sein und so die Wettbewerber auch selbst unter Druck zu setzen.
Da es im Lernprozess auch dazu kommen wird, dass sich die Dinge nicht so entwickeln wie erhofft, lernen die Teams und die Organisation auch den Umgang mit dem Scheitern von Ideen. Auch dazu ein Beispiel aus dem Regelwerk von 3M: Dort werden über die Hälfte der Projekte vorzeitig abgebrochen. Manchmal, weil sich die Idee nicht realisieren lässt, meist jedoch, weil die betriebswirtschaftlichen Ziele nicht erreicht werden können. Die Lösung wäre zu teuer. Die Projektergebnisse werden dann genauso wie die der erfolgreichen Projekte dokumentiert und in das Wissensmanagement eingebunden. Man hat eine Menge gelernt, was bezahlt wurde und nicht weggeworfen werden soll. Dadurch entsteht auch kein Makel des Scheiterns bei Projektteams oder Verantwortlichen, da dieses Schicksal den meisten Projekten widerfährt.
Wer Erfolg haben will, muss auch mit dem Scheitern umgehen können. Eine Analogie aus dem Tennis illustriert dieses Prinzip aus einer anderen Sicht. Wer einen besseren ersten Aufschlag spielen möchte, kann das dadurch erreichen, dass die Person ihren zweiten Aufschlag stabilisiert. Mit dieser Sicherheit im Rücken verbessert sich der erste Aufschlag bei vielen Spielerinnen und Spielern automatisch.
Die Kosten – Trägt sich das Modell?
"Zehn Prozent unserer Arbeitskapazität einfach mal so eben abziehen und nicht dafür einsetzen, Umsatz zu generieren, kann sich doch kaum jemand leisten!" So oder ähnlich werden die Gedanken in Euren Köpfen beim Lesen des Artikels sein. Eine kleine Beispielrechnung relativiert das Ganze. Schauen wir genauer hin.
Betrachten wir die Kosten für 25 Personen pro Jahr bei einem kontinuierlichen Lernprozess im Vergleich zu einer punktuellen, nachträglichen Trainingsmaßnahme und den sich daraus ergebenden Konsequenzen (Tab. 1). Die Rechnung basiert auf einem durchschnittlichen IT-Gehalt von 72.000 € / Jahr und 25 Prozent Nebenkosten sowie 10.000 € pauschal für Infrastrukturkosten (62,50 €/h bei 180 fakturierbaren Tagen).
Tabelle 1: Kostenvergleich - oben: kontinuierlicher Lernprozess, unten: punktuelle Trainingsmaßnahme 1x pro Jahr
| Prozess | Aufwand / Monat | Kosten / Jahr | Bemerkung |
| Lernprozess intern | 500 h | 375.000 € | 25 Personen mit 20 h pro Monat |
| Lernprozess – externer Support | 24.000 € | 1 Tag pro Monat externe Beratungsleistung zu 2.000 € pro Tag | |
| Wissensmanagement | 100 h | 75.000 € | 25 Personen mit 4 h pro Monat |
| Summe | 600 h | 474.000 € | Entspricht 900 PT (Personentagen) |
| Aufwand / Monat | Kosten / Jahr | Bemerkung | |
| Nachträgliche Trainings | 125 PT | 62.500 € | 5-Tages-Schulung, 25 Personen |
| Trainerkosten | 37.500 € | Drei 5-Tages-Inhouse-Schulungen zu 2.500 € pro Tag | |
| Transferleistung | 375 PT | 187.500 € | Typischerweise 5 Tage pro Person und Monat bei 3 Monaten Transferdauer |
| Wissensmanagement | 150 PT | 75.000 € | s.o. (100 h x 12 = 1.200 h pro Jahr) |
| Summe | 650 PT | 362.500 € |
Rechtfertigt ein Unterschied von 110.000 € das Risiko, nicht auf aktuellem Stand und unflexibel zu sein? Wenn wir noch den Aspekt mitbetrachten, dass uns ehrgeizige Mitarbeitende verlassen, weil sie sich in einer anderen Firma kontinuierlich weiterentwickeln können, wird die finanzielle Lücke bereits geschlossen. Oder andersherum argumentiert: Als Organisation, die kontinuierlich lernt, sind wir auf dem engen Arbeitsmarkt auch bei durchschnittlichen Gehältern besonders attraktiv.
Dieses Rechenbeispiel gibt uns die finanziellen Größenordnungen, die auf mittelständische Firmen zukommen, wenn sie sich zu einer lernenden Organisation entwickeln. Nicht alle Mitarbeitenden werden sich in die Lernprozesse einbringen, so dass die Zahlen einen brauchbaren Anhaltspunkt liefern. Auch werden die Kosten nachträglicher Schulungen gerne auf die reinen Trainingskosten reduziert. Die größten Faktoren stellen dabei jedoch die Arbeitszeit der Mitarbeitenden sowie der Transfer des Gelernten in die eigene Praxis dar.
Agile auf den diesjährigen IT-Tagen
Spannende Vorträge und Workshops zum Thema Agile erwarten Euch auch auf den IT-Tagen, der Jahreskonferenz von Informatik Aktuell. Die IT-Konferenz findet jedes Jahr im Dezember in Frankfurt statt – dieses Jahr vom 08.-11.12.
Fazit
Auf dem Weg zu einer lernenden, resilienten Organisation ist viel zu beachten. Kernelement ist es, Lernprozesse aufzusetzen, die die Ergebnisse psychologischer Untersuchungen berücksichtigen und kontinuierlich parallel zum Tagesgeschäft laufen. Durch ein unterstützendes Regelwerk und passende Rahmenbedingungen wird so nicht nur das Lernen gelernt, sondern auch die Flexibilität der Teams erhöht und die Resilienz der Organisation weiterentwickelt. In diesem Rahmen können dann auch Innovationen entstehen.
Auch wenn ich in diesem Artikel immer wieder stark auf die dahinter liegende Theorie eingegangen bin, geht es bei lernenden Organisationen primär um die praktische Arbeit. Wir lernen durch Erfahrung, die wir aus dem eigenen Handeln gewinnen. In einem Rahmen, der über wenige Regeln das Lernen fördert und die Lernprozesse regelmäßig mit den Zielen in Einklang bringt, gewinnen wir doppelt: Unsere Mitarbeitenden haben Spaß bei der Umsetzung ihrer Ideen, was auch die Fluktuation minimiert, und die Reaktionsgeschwindigkeit unserer Organisation wird permanent trainiert.
- P. G. Zimbardo, R. J. Gerrig: Psychologie, 7. Auflage, Springer, 1999
- L. v. Rosenstiel: Grundlagen der Organisationspsychologie, 6. Auflage, Schäffer Poeschl, 2007
- D. A. Kolb: Experiential Learning – Experience as the Source of Learning and Development, 2nd edition, Pearson, 2015
- U. Vigenschow: Lernende Organisationen – Das Management komplexer Aufgaben und Strukturen zukunftssicher gestalten, dpunkt.verlag, 2021
- I. Nonaka, H. Takeuchi: Die Organisation des Wissens – Wie japanische Unternehmen eine brachliegende Ressource nutzbar machen, Campus, 1997
- G. Wohland, M. Wiemeyer: Denkwerkzeuge der Höchstleister – Warum dynamikrobuste UnternehmenMarktdruck erzeugen, 3. Auflage, Unibuch, 2012








![Ein zyklischer Lernprozess für Gruppen Abb. 2: Ein zyklischer Lernprozess für Gruppen [3,4]. © U. Vigenschow](/fileadmin/templates/wr/pics/Artikel/01_Management/Projektmanagement/zyklischer_Lernprozess_f%C3%BCr_Gruppen_abb2.png)

![Wissensmanagement in Organisationen nach Nonaka und Tekeuchi Abb. 4: Wissensmanagement in Organisationen nach Nonaka und Tekeuchi [4,5]. © U. Vigenschow](/fileadmin/_processed_/c/6/csm_Wissensmanagement_in_Organisationen_abb4_378da41669.png)