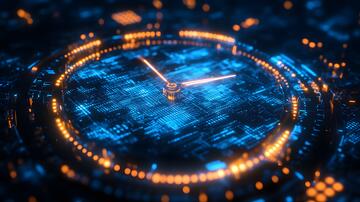Whole Team Testing mit Liberating Structures

Pair und Ensemble Testing haben ihren festen Platz im Kanon des agilen Testens. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf einer kollaborativen Testdurchführung. Auch sind Konzepte wie das Whole Team Approach to Testing fest im Alltag agiler Teams verankert. Qualität kann nicht am Ende in das Produkt "hineingetestet" werden, sondern muss im ganzen Entwicklungsprozess mitgedacht und implementiert werden. Dieser Prämisse werden die wenigsten widersprechen. Wenn man nun aber den Alltag vieler Teams betrachtet, kommt man zwangsläufig an einer Frage nicht vorbei: Wie kann man gemeinsam Aktivitäten rund um das Thema "Testen und Qualität" im Team angehen, die über die Testausführung hinausgehen?
Hier kommen nun Liberating Structures ins Spiel. Liberating Structures – kurz LS – sind ein Werkzeugkasten zum Moderieren von Terminen und Workshops, der unter anderem ein Augenmerk darauf legt, alle Anwesenden gleichermaßen zu involvieren und nicht nur diejenigen, die gerne ihre Stimme hören [1]. Das gemeinsame Entdecken und Bearbeiten eines Themas stehen somit im Vordergrund.
Im Rahmen dieses Artikels werde ich nach einer kurzen theoretischen Einführung in das Thema Liberating Structures den Fokus auf die Verknüpfung der Themen "Gemeinsames Arbeiten im Testprozess" und "Liberating Structures" legen. Es wird weiterhin exemplarisch beschrieben, wie eine konkrete Methode aus dem LS-Baukastensystem im jeweiligen Prozessschritt angewendet werden kann – basierend auf Erfahrungswerten aus dem Alltag.
Liberating Structures
Liberating Structures sind eine von Henri Lipmanowicz und Keith McCandless etablierte Sammlung mit kontextabhängigen Moderationsformen und -techniken für (Groß-)Gruppen. Insgesamt besteht die Sammlung aus über 30 offiziellen und einigen experimentellen Structures – also Moderationsformen.
Nicht jede Structure eignet sich für jedes Ziel, daher werden innerhalb der Sammlung sechs Kategorien von Moderationsformen unterschieden, um eine erste grobe Einordnung zu haben.
- Reveal: Structures dieser Kategorie verfolgen das Ziel, Themen aufzudecken – bisher Implizites explizit zu machen.
- Spread ideas: Structures dieser Kategorie helfen dabei, Kopfmonopole aufzulösen und Wissen in die Breite zu tragen. Hier geht es oft auch darum, alle Beteiligten auf einen Stand zu bringen.
- Analyse: Manchmal möchte man Sachverhalte und Inhalte gemeinsam analysieren. Hier helfen die Structures dieser Kategorie.
- Help: Hilfe bekommen und vor allem Hilfe einfordern sind die zentralen Elemente dieser Structures. Insbesondere Letzteres fällt nicht immer leicht, so dass eine geführte Structure hier helfen kann.
- Strategize: Gemeinsam Strategien entwickeln und bestehende Strategien auf den Prüfstand stellen – Gerade das Hinterfragen bestehender Strategien kommt im Alltag häufig zu kurz.
- Plan: Gemeinsam planen und die Strategien gemeinsam mit Leben füllen.
Unabhängig davon, zu welcher Kategorie eine Liberating Structure gehört, basieren alle Structures auf grundlegenden zehn Prinzipien, die wir immer wiederfinden, wenngleich auch in unterschiedlicher Stärke.
- Include and unleash everyone: Menschen haben unterschiedliches Kommunikationsverhalten. Manche reden mehr, manche weniger. Die Anzahl guter Ideen und Argumente korreliert jedoch nicht mit den Sprechanteilen, daher ist es den Liberating Structures ein Anliegen, alle Beteiligten zu involvieren und auch den Ideen derjenigen, die sonst eher weniger im Gesprächsmittelpunkt stehen, den Raum einzuräumen, den diese Ideen verdienen.
- Practice deep respect for people and local solutions: Im Schwedischen gibt es ein Sprichwort, das sinngemäß besagt, dass derjenige, der den Schuh trägt, am besten weiß, wo er drückt. In eine ähnliche Richtung geht dieses Prinzip. Es gilt, lokale Lösungen zu finden und vor allem zu erlauben – von Menschen, die hinterher direkt mit dieser Lösung arbeiten bzw. direkt von ihr betroffen sind. Statt des ständigen Impulses externer Experten, die dann gelegentlich doch etwas generisch unterwegs sind, wird das Augenmerk auf die betroffenen Personen selbst gelegt.
- Build trust as you go: Funktionale und performante Teams haben eine gemeinsame Vertrauensbasis, auf der sie aufbauen und die es ihnen ermöglicht, fachliche Konflikte schnell und gut zu lösen. Dieses Vertrauen kommt jedoch nicht aus dem Nichts, sondern muss geschaffen werden. Im Projektalltag soll dies natürlich am besten gestern geschehen. Liberating Structures haben das Element des Vertrauensaufbaus fest integriert, um Kommunikation ganz grundlegend zu ermöglichen.
- Learning by failing forward: Scheitern kann ein wichtiger Bestandteil des Lernens und Entwickelns sein. Daher kann es sinnvoll sein, Scheitern fest zu integrieren, um vorwärtszukommen.
- Practice self-discovery in a group: Lösungen und Ideen sind nachhaltiger, wenn sie aus einer Gruppe heraus entstehen. Das Erreichen von Selbsterkenntnis wird durch Liberating Structures hier unterstützt.
- Amplify freedom and responsibility: Agilität ist inzwischen ja weit verbreitet und selbstorganisierte Teams sind keine Konstrukte einer fernen Märchenwelt. Selbstorganisierte Teams zeichnen sich durch große Freiheiten aus, die gleichzeitig auch große Verantwortung mit sich bringen. Liberating Structures wollen nun diese Freiheiten bestärken und gleichzeitig auch das Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten fördern.
- Emphasize possibilities: Believe before you see: Hier geht es um Gedankenspiele und mentale Walkthroughs. Wenn wir die Möglichkeiten bereits im Vorfeld durchgehen und visualisieren, werden sich einerseits neue Ideen entwickeln und andererseits wird ein positives Umfeld für Änderungen geschaffen.
- Invite creative destruction to enable innovation: Schon in Goethes Faust heißt es "...denn alles, was entsteht, Ist wert, daß es zugrunde geht,". Dieses Prinzip widmet sich sinngemäß dem Abschneiden alter Zöpfe. Viele Ideen und Prozesse, die über die Jahre entstanden sind, hatten ihre Berechtigung. Die Frage ist nun vielmehr, ob sie diese immer noch haben. Daher lohnt es sich, diese Themen einmal kreativ auseinanderzunehmen, um Raum für Neuerungen zu schaffen.
- Engage in seriously-playful curiosity: Spielerische Neugier wird im beruflichen Kontext häufig etwas belächelt. Zu Unrecht! Wenn sie gezielt genutzt wird, kann sie stark helfen, das intrinsische Interesse von Menschen an einem Thema zu wecken und zu bestärken.
- Never start without a clear purpose: Manchmal sitzt man in Meetings und fragt sich: "Warum bin ich eigentlich hier?" Genau das sollte aber eigentlich nicht der Fall sein. Jedes Meeting, jede Veranstaltung sollte ein klares Ziel haben – vom Raum für Austausch bis hin zum Lösen eines konkreten Problems. In genau dieser Bandbreite finden sich auch die diversen Liberating Structures wieder und vor allem gibt es hier eine direkte Beziehung zwischen dem Ziel oder Anlass und der Auswahl der entsprechenden Structure.
Auf Basis dieser Prinzipien funktionieren die verschiedenen Structures und während alle eine Grundstruktur haben, sind viele adaptierbar, ohne diese Prinzipien zu verletzen und somit situativ kontextbezogen sinnvoll nutzbar. Von einer zeitlichen Anpassung über die heutzutage allgegenwärtigen Onlinevarianten bis hin zur Kombination mit Moderationstechniken, die nicht Teil des Kanons sind, ist hier vieles möglich.
Liberating Structures sind insgesamt betrachtet überall dort einsetzbar, wo es um die Themen Kollaboration und Gruppenmoderation geht. Im weiteren Verlauf werden wir eine konkrete Nutzung im Rahmen des Themas Software-Testing betrachten.
Whole Team Testing und Liberating Structures
Im Laufe der Zuwendung zur Agilität haben wir einen Wandel von strikt funktionalen Teams und Einheiten, die an einen Prozessschritt im Software-Entwicklungs-Lebenszyklusmodell gekoppelt waren, hin zu interdisziplinären Teams beobachtet. Da in diesen gemeinsam und aufgabenorientiert gearbeitet wird, wird einerseits deutlich mehr kollaboriert und andererseits heißt es unter dem Schlagwort "Effektivität über Effizienz", dass Personen Tätigkeiten übernehmen, die gerade dringlich sind, auch wenn sie nicht deren absoluten Kernkompetenzen entsprechen. Es geht also vielmehr darum, dass wir die Aufgaben erledigen, wenn sie anfallen, als dass wir immer die beste Person für die Aufgabe zuteilen. Für das Thema Testen hat sich hier, u. a. durch die Bücher "Agile Testing" und "More Agile Testing", der Ansatz des Whole Team Approach to Testing etabliert, der diesen geänderten Rahmenbedingungen Rechnung trägt [2]. Vereinfacht gesagt haben wir es immer noch mit einem Testprozess zu tun, der nun aber gemeinsam betrachtet und bedient wird. Genau an dieser Stelle kommen nun die Liberating Structures ins Spiel, da sie Methoden und Moderationsformen liefern, wie wir uns der einzelnen Prozessaktivitäten gemeinsam annehmen können. Die folgende Auswahl ist natürlich nur beispielhaft, dafür beruht sie auf der Erfahrung verschiedener Projekte, die sie für die jeweiligen Zwecke erfolgreich angewendet haben.
Verschiedene Lehrpläne wie BBST oder ISTQB postulieren Testprozesse und Vorgehensweisen, die sich in ihren Grundzügen ähneln [3]. Weiterhin werden innerhalb dieser Prozesse Zwecke festgelegt und mit einzelnen Aktivitäten verknüpft. Im Hinblick auf die oben beschriebenen LS-Prinzipien wird also der "clear purpose" bereits durch den Prozess vordefiniert.
Die folgende Tabelle zeigt einen generischen Testprozess, losgelöst von etwaigen Ausbildungsprogrammen. Die Inhalte von ISTQB und BBST lassen sich jedoch direkt hierauf abbilden.
| Aktivität | Zweck |
| Planung | Ziele und Rahmenbedingungen festlegen |
| Design | Identifizieren von Testinhalten |
| Implementierung | Schreiben und Konkretisieren von Tests |
| Durchführung | Ausführen und Tests inkl. Folgeaktivitäten wie Fehlerberichte, Berichtswesen etc. |
| Abschluss | Nachbetrachtung, Retrospektiven, Nacharbeiten |
Planung
Zwei Kategorien der Liberating Structures sind mit Plan bzw. Strategize betitelt und das ist der Kerninhalt dieser Aktivität. Wir legen eine Testmission fest, stecken Ziele ab – nein, es geht nicht nur um das Finden von Fehlern -, identifizieren, welche Rahmenbedingungen es gibt und mit welchen Vorgehensweisen wir unter den gegebenen Rahmenbedingungen die Mission und die Ziele angehen und im Optimalfall auch erreichen wollen. Dies ist klassischerweise die Spielwiese von Test-Manager:innen gewesen, im Sinne des Whole Team Testing ist dies natürlich eine gemeinsame Aktivität eines Teams. Zwei Liberating Structures, die sich hier als hilfreich erwiesen haben, sind "Impromptu Networking" und "From Purpose to Practice".
Impromptu Networking
- Slogan: Teile rasch Herausforderungen und Erwartungen und bilde neue Verbindungen!
- Leitfrage: Warum bist du heute hier?
- Setup:
- 1 Minute: Beantworte die Frage für dich allein.
- 4 Minuten: Tauscht euch in Kleingruppen (am besten zu zweit) dazu aus. Verteilt die Redezeit bitte gleich.
- 8 Minuten: Nochmals zwei Runden – allerdings mit anderen Partnern.
Impromptu Networking legt den Fokus auf das Kennenlernen anderer Teilnehmer und auf den Austausch über Erwartungen und eignet sich somit hervorragend für den Einstieg in gemeinsame Termine. Diese Structure funktioniert wunderbar sowohl mit Gruppen, die sich noch nicht kennen als auch mit Gruppen, die schon länger zusammenarbeiten. Es verschiebt sich hierbei jeweils immer etwas der Fokus in Richtung des Kennenlernens oder der Klärung etwaiger Erwartungshaltungen. Besonders hilfreich ist es für mich bei Kick-Off-Veranstaltungen oder Qualitäts-Workshops gewesen. Hier lässt sich mit dieser Methodik schnell ein gemeinsamer Tenor finden – oder auch ein fundamental unterschiedliches Verständnis über den Sinn und Zweck einer Veranstaltung aufdecken. Impromptu Networking ist nicht primär an die Testaktivität Planung gebunden, sondern eher an Termine und Workshops, da diese aber in der Planung vermehrt stattfinden, erscheint eine Einordnung an dieser Stelle bereits angebracht. Weiterhin lässt sich mit der Zeiteinteilung hier wunderbar spielen, so dass sie an die Länge der Gesamtveranstaltung angepasst werden kann.
Purpose-2-Practice (P2P)
- Slogan: Gestalte die fünf essenziellen Bestandteile einer erfolgreichen und nachhaltigen Initiative!
- Leitfrage: Wie könnte eine Teststrategie in diesem Projekt aussehen?
Unter der Leitfrage werden 5 spezielle Punkte betrachtet:
1. Purpose: Welchen Zweck hat Testen in diesem Szenario? Warum ist Testen wichtig für das Team?
2. Principles: Welche Testprinzipien greifen in diesem Szenario? Was muss getan werden, damit Testen erfolgreich ist?
3. Participants: Wer kann zum Testen beitragen? Wer sollte involviert werden?
4. Structure: Wie wird das Testen organisiert? Welche Personen und Rollen werden benötigt? Welche Werkzeuge werden benutzt?
5. Practice: Was machen wir als Erstes? Wie sieht die Praxis aus? Was machen wir nicht? - Setup: Iterativ werden die 5 Punkte und die jeweiligen Fragen diskutiert. Bewährt hat sich dazu folgendes Schema:
- 1 Minute allein: Denke über den jeweiligen Punkt nach.
- 4 Minuten zu zweit: Diskutiert eure Antworten.
- 8 Minuten in 4 Gruppen: Sammelt und konsolidiert eure Antworten auf einem Flipchart.
- 4 Minuten: Müssen wir die vorherigen Runden auf Basis dieser Runde anpassen?
Am Ende dieser Struktur steht nicht zwangsläufig ein fertiges Dokument, das eventuell sogar regulatorischen Ansprüchen genügt, sondern eine abgestimmte und konsolidierte Sammlung von Inhalten, die den Kern einer Teststrategie bilden und somit bei Bedarf als Input für ein Testkonzept genutzt werden kann. Ob dies nun regulatorischen Ansprüchen genügen muss oder ob um es sich um einen One-Page-Testplan im Sinne eines Flipcharts handelt, die an der Bürowand hängt, ist dabei unerheblich. Beide Extreme basieren auf dem gemeinsam entstandenen Input und bilden nur die Dokumentation des gemeinsamen Verständnisses ab. Die Zeitangaben oben sind aus meiner Sicht die unteren Grenzen und bieten viel Luft nach oben. In der allgemeinen Methodenbeschreibung zu P2P stehen Zeitangaben von 120 Minuten bis 5 Tage. Sich diese Zeit für eine Teststrategie in einem neuen Projekt zu nehmen, erscheint auch mehr als angebracht, wenn Testen mehr als nur den Anspruch einer oberflächlichen Anforderungsbestätigung erfüllen soll.
Design
Wenn man Social Media glauben mag, so steht im Englischen QA nicht nur für Quality Assurance, sondern auch für Question Asker. Und Fragen zu stellen ist eine der wichtigsten Fähigkeiten im Rahmen des Testdesigns. Es geht hier darum, Informationen zu bekommen, wie Tests im Nachhinein konkret aussehen können. Auch wenn man gute und belastbare Anforderungen hat, so bleibt das Hinterfragen dieser ein zentrales Element des Testens. Weiterhin ist eine oft unterschätzte Fähigkeit eines Testers das Zuhören, ohne welches Informationsgewinnung in zunehmend kollaborativen Umfeldern, deren Kommunikation verbal und synchron stattfindet, so gut wie unmöglich ist. Liberating Structures bieten hier mit Troika Consulting eine Möglichkeit, um sowohl das Fragenstellen als auch das Zuhören systematisch anzugehen.
Troika Consulting
- Slogan: Erhalte und gib praktische und einfallsreiche Hilfe!
- Leitfrage: Welche impliziten Annahmen gilt es bei diesem Thema für die Testfallerstellung zu berücksichtigen?
- Setup:
- 1 Minute: Beantworte die Frage für dich alleine.
- In Gruppen zu dritt:
- 1 Minute: Person 1 stellt das Problem vor.
- 2 Minuten: Person 2 und 3 stellen Klärungsfragen.
- 4 Minuten: Person 1 dreht sich um, Personen 2 und 3 diskutieren das Problem und mögliche Lösungen.
- 1 Minute: Person 1 gibt den anderen beiden Feedback.
- Anschließend zwei weitere Runden, in denen Personen 2 und 3 ihre Probleme vorstellen.
Der Fokus dieser Structure liegt, wie bereits dargestellt, auf dem aktiven Hören und dem Generieren von Ideen. Schritt 3 verstärkt das Hören, insbesondere durch das Umdrehen. Da hier die Diskussion "hinter dem Rücken" stattfindet, wird die nonverbale Kommunikation und der Drang, in die Diskussion einzugreifen, unterdrückt. Gerade dieser Drang einzugreifen jedoch ist es, der häufig das Entstehen von Ideen unterbindet. Schritt 4 gibt jedoch dann explizit die Möglichkeit für ein Feedback, so dass der Zuhörende seine Gedanken sortieren und artikulieren kann. Hier entstehen häufig keine konkreten Lösungen, sondern Ideen und Ansätze, deren Verfolgung lohnenswert erscheint und die sonst womöglich gar nicht erst entstanden wären. Eine Variation dieser Structure ermöglicht es einem Fragensteller, von unterschiedlichen Gruppen Input zu bekommen. Im optionalen Schritt haben wir 3-4 Gruppen, die parallel Troika Consulting betreiben und nach Abschluss der ersten Runde werden nun nicht die Rollen getauscht, sondern die diskutierenden Personen rotieren weiter, während die Fragensteller verbleiben. Diese Variante ermöglicht es, insbesondere aus verschiedenen Perspektiven und Gruppen Feedback zum gleichen Thema zu bekommen. In der Praxis hat es sich als hilfreich erwiesen, wenn die Fragensteller mit Zettel und Stift bereits Notizen machen, während hinter ihrem Rücken diskutiert wird, um der schieren Masse an Input gerecht zu werden.
Implementierung
Der Übergang von Design zu Implementierung ist in vielen Projekten fließend. Nachdem im Design geklärt wurde, was überhaupt zu tun ist, gilt es, dies nun in Form von Testcharters oder Testfällen festzuhalten, um letztendlich alles so weit vorzubereiten, dass die Tests gestartet werden können. In den Rahmen der Implementierung fällt auch das Vorbereiten der Durchführung, wie etwa das Vorbereiten der Testumgebungen. Eine Frage, die hier allgegenwärtig ist, lautet "Haben wir an alles gedacht?" Während vielleicht nicht alles möglich oder auch gar nicht sinnvoll ist, ist die Frage nach den wichtigen Aspekten mehr als berechtigt. Hier kann die Structure "TRIZ" helfen, die sich des Prinzips "Invite creative destruction to enable innovation" bedient.
TRIZ
- Slogan: Stoppe kontraproduktive Aktivitäten und Verhaltensweisen!
- Leitfragen:
1. Welche Probleme hinsichtlich der Testumgebungen könnten potenziell auftauchen?
2. Welche dieser Probleme kennen wir aus der Vergangenheit bereits?
3. Was könnten mögliche Ideen sein, um diesen Problemen zu begegnen? - Setup: Diese drei Leitfragen werden jeweils nacheinander beantwortet:
- Leitfrage 1:
- 1 Minute: Beantworte die Frage für dich allein. Es ist okay, zu übertreiben und außerhalb bekannter Pfade zu denken.
- 2 Minuten: Tauscht euch in Kleingruppen (am besten zu zweit) dazu aus.
- 5 Minuten: Bildet vier Gruppen und diskutiert die Erkenntnisse der vorherigen Runde. Sammelt eure Punkte in einer Liste.
- 1 Minute pro Gruppe: Stellt eure Ergebnisse der Gesamtgruppe vor.
- Leitfrage 2: Die vier Gruppen bleiben bestehen und wechseln die Listen, so dass für diese Leitfrage jeweils die Erkenntnisse einer anderen Gruppe betrachtet werden.
- 1 Minute: Betrachte und beantworte die Frage für dich alleine.
- 2 Minuten: Tauscht euch in Kleingruppen (am besten zu zweit) dazu aus.
- 5 Minuten: Diskutiert gemeinsam in der Gruppe. Markiert diejenigen Punkte, die euch bereits begegnet sind. Wenn es viele sind, markiert diejenigen, die euch am wichtigsten erscheinen.
- 1 Minute pro Gruppe: Stellt eure Ergebnisse der Gesamtgruppe vor.
- Alternativ zu diesem 1-2-4 Format kann auch eine Kleingruppendiskussion geführt werden. Dies entscheide ich als Moderator häufig ad hoc und hängt von den Teilnehmenden ab. Sind Redeanteile gleich verteilt, ist die Kleingruppendiskussion oft genauso effektiv.
- Leitfrage 3: Die Gruppen bleiben bestehen und das Vorgehen ist analog zur Leitfrage 2. Es wird jetzt allerdings der Lösungsraum aufgemacht. In den 10 Minuten werden sicherlich keine fertigen Strategien zur Risikominimierung entstehen, häufig jedoch entstehen Ideen und Impulse, die es lohnt, weiter zu verfolgen.
Der Fokus dieser Structure verschiebt sich meines Erachtens mit den Leitfragen, beginnend mit dem Erkennen und Offenlegen von Unzulänglichkeiten hin zum Adressieren dieser. TRIZ greift hier insbesondere auf die beiden Prinzipien "Invite creative destruction to enable innovation" und "Emphasize possibilities". Gerade Frage 1 ist in dieser Hinsicht sehr stark und Teilnehmende sind hier oft noch sehr zurückhaltend. Einer meiner Standardhinweise in der Durchführung hier lautet: "Es ist okay und gewollt zu übertreiben. Denk ruhig mal an extreme Sachen wie Vulkanausbrüche." Dies sorgt gelegentlich für ein Schmunzeln, aber bei einem Teilnehmer hat es dazu geführt, dass er erwähnte, dass das Rechenzentrum direkt am Rhein liegt und sie schon mit Hochwasser zu kämpfen hatten. Solche Assoziationen sind an dieser Stelle goldwert, da sie das gewollte Übertreiben noch verstärken.
Durchführung
Die eigentliche Durchführung von Tests ist in vielen Teams inzwischen auch keine Tätigkeit mehr, die alleine vor dem Rechner stattfindet. Vorgehensweisen wie Pair Testing und Ensemble Testing sind weit verbreitet und etabliert. Unabhängig von der Anzahl der involvierten Personen gilt es immer noch, Fragen zu beantworten wie "Sind wir fertig?" oder "Haben wir mit der Software ein auslieferungsfähiges Niveau erreicht?" Will man sich dieser Frage nicht aus den klassischen Perspektiven "Management entscheidet" oder "vordefinierte Testendekriterien" nähern, bietet die Structure "Anxiety Circus" hier einen kollaborativen Ansatz.
Anxiety Circus
- Slogan: Identifiziere die größten Sorgen, Ängste und Bedenken einer Gruppe!
- Leitfrage: Was hält uns gerade davon ab, freizugeben? Welches sind unsere größten Bedenken?
- Setup:
- 2 Minuten: Schreibe deine größte Sorge bzw. deine größten Bedenken, warum wir nicht freigeben sollten, auf eine Karte.
- 5x 2 Minuten: Teilnehmende bewegen sich durch den Raum und tauschen ständig ihre Karten, so dass jede Person mehrere Karten einmal in der Hand hatte. So soll eine Durchmischung erzielt werden. Die Karten sollten mit der Sorge nach oben getauscht werden, damit ab Runde 2 die Bewertung nicht offensichtlich wird. Nach dem Durchtauschen lesen sich alle Teilnehmenden die Karte durch, die gerade in ihren Händen ist und überlegen sich eine Bewertung von 1 bis 5, wobei die Höhe angibt, wie sehr diese Sorge geteilt wird. Anschließend wird die Karte umgedreht und die Bewertung auf die Rückseite geschrieben. Diese Runde wird insgesamt fünf Mal wiederholt.
- 1 Minute: Alle Teilnehmenden sollten jetzt eine Karte mit 5 Bewertungen vor sich haben. Diese werden nun addiert, um eine Gesamtbewertung zu erhalten.
- 10 Minuten: Die Karten werden hinsichtlich ihrer Gesamtbewertung sortiert. Ein mögliches Vorgehen ist es, die Bewertungen absteigend von 25 durchzugehen, alternativ hat sich auch das gemeinsame Sortieren der Karten auf einem Tisch bewährt. Am Ende haben wir eine Liste und Sortierung der größten Sorgen und Bedenken hinsichtlich der Freigabe. Die größten Sorgen und Bedenken können nun anschließend besprochen und adressiert werden.
Bewährt haben sich an dieser Stelle auch Grenzwerte, so kann beispielsweise eine Untergrenze festgelegt werden, unter der die Karten nicht in der Gruppe besprochen werden, da die Gesamteinschätzung zu niedrig ist. Manche Teams nutzen hier auch einen Grenzwert zur Freigabe. Wenn keine Karte diesen Grenzwert überschreitet, dann steht einer Auslieferung nichts mehr im Wege, da die Gruppe das Risiko als akzeptabel bewertet.
Abschluss
In agilen Teams wird gelegentlich diskutiert, ob es so etwas wie einen Abschluss der Testaktivitäten überhaupt gibt, aber auch hier gibt es zumindest einen Abschluss der Iteration, der einen guten Zeitpunkt darstellt, um im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung eine Retrospektive der Testaktivitäten zu starten. Retro-Formate gibt es viele und auch der Baukasten der Liberating Structures bietet hier einiges. Häufig wird in Retros nach globalen Lösungen gesucht, manchmal können aber auch die kleinen Dinge einen positiven Effekt erzielen. Mit "15% Solutions" sollen diese kleinen Dinge gefunden werden.
15% Solutions
- Slogan: Fokussiere dich auf Maßnahmen, die du sofort und ohne fremde Hilfe oder Ressourcen umsetzen kannst!
- Leitfrage: Was kannst du sofort und direkt ändern, um Problem x anzugehen?
- Setup: Die Structure baut darauf auf, dass bereits ein Problem identifiziert wurde. Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Leitfrage auch generischer interpretiert werden im Sinne von: "Was kannst du sofort ändern, um in der nächsten Iteration besser testen zu können?"
- 5 Minuten: Alle Teilnehmenden erstellen eine individuelle Liste mit Ideen und Maßnahmen, die auf die Leitfrage einzahlen.
- 20-30 Minuten: Zu zweit oder dritt werden reihum die Listen vorgestellt und diskutiert. Durch aktives Nachfragen und das Angebot von Feedback wird der erstellenden Person geholfen, die Punkte der Liste noch einmal nachzuschärfen.
Der Fokus dieser Structure liegt auf dem Prinzip "Practice deep respect for people and local solutions". Als Individuum kann ich nicht immer direkt Einfluss auf das große Ganze nehmen, ich kann aber an kleineren Stellschrauben drehen, die in Summe einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf jenes große Ganze haben. Es geht also darum, den Gestaltungsspielraum, den mir Strukturen und Prozesse – mal mehr, mal weniger – bieten, zu nutzen, um das Beste daraus zu machen.
Fazit
Wer sich die offiziellen Beschreibungen der hier erwähnten Structures durchliest – und ich empfehle dies ausdrücklich –, wird feststellen, dass ich an einigen Stellen leicht vom Format abgewichen bin, sei es aus Gründen des Zeitmanagements oder um das Themenfeld "Testen" besser verorten zu können. Dieser Artikel soll sich auch gar nicht so sehr den Liberating Structures per se widmen, als vielmehr einen konkreten Anwendungsfall aufzeigen.
Die beschriebenen Structures haben sich für mich in dieser Form bewährt und ich konnte sie in Projekten und Teams erfolgreich anwenden. Das heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass dem immer und überall so ist, aber sie können meines Erachtens zumindest als Inspiration dienen und vielleicht neue Ideen bringen und fördern somit das Liberating-Structures-Prinzip "Include and unleash everyone".
Wer sich für die Hintergründe oder eine detaillierte Beschreibung aller Methoden interessiert, sei an das Buch "The Surprising Power of Liberating Structures" verwiesen [4]. Sehr hilfreich für Moderatoren ist auch die Liberating-Structures-App, die in den jeweiligen Appstores frei verfügbar ist [5].
- Liberating Structures.de
Liberating Structures.com - J. Gregory, L. Crispin, 2008: Agile Testing
J. Gregory, L. Crispin, 2014: More Agile Testing - The BBST Story
German Testing Board e.V.: Lehrplan Certified Tester Foundation Level - H. Lipmanowicz, K. McCandless, 2014: The Surprising Power of Liberating Structures: Simple Rules to Unleash A Culture of Innovation
- Liberating-Structures-App