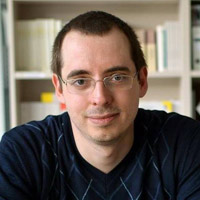Gamification und Scrum: Alles (nur) ein Spiel

Fortschrittsdiagramm, Story-Punkte und Teamwork – Scrum beinhaltet schon heute einige Gamification-Elemente. Wir untersuchten, wie sich weitere Motivatoren aus dem Spiele-Kontext integrieren lassen. Unser Ergebnis: Gamification und Scrum passen sehr gut zueinander, wenn man gewisse Stolperfallen vermeidet.
Wer schon einmal so sehr in einem Computerspiel versunken ist, dass er Zeit und Raum völlig vergessen hat, kennt das Prinzip des "Flow". Dieser Zustand der vollen Konzentration und Hingabe an eine Tätigkeit [1] ist kein Zufall. Gute Computerspiele sind gerade so konzipiert, dass sie uns motivieren, auch immer gleichbleibende Tätigkeiten beinahe besessen immer wieder durchzuführen, um zum nächsten Level zu gelangen – und das aus freien Stücken. Ein gutes Spiel besitzt Elemente, die uns durch ihre Triebkräfte zu verschiedenen Aktivitäten motivieren [2].
Wie wäre es, wenn man sich nicht nur in privatem Spiel, sondern auch in beruflichen Aufgaben so produktiv verlieren könnte? Wenn man die Hausarbeit oder das IT-Projekt im "Flow" absolvieren könnte? Möglich machen könnte diese Vision ein Konzept namens Gamification. Gerade Softwareingenieuren sind viele Elemente der Gamification aus Ihren oft digitalen Hobbies bekannt. Es liegt somit nahe, diese Elemente auch in den Projektalltag zu integrieren.
Wir möchten in diesem Artikel Gamification in agilen Softwareentwicklungsprojekten betrachten. Hier hat sich Scrum als Rahmenwerk etabliert. Dies hat vielfältige Gründe; ein besonderer Grund mag sein, dass Scrum bereits in seinem Konzept einige Elemente zur Motivationssteigerung des Teams enthält. Dazu zählen etwa die Autonomie des Teams oder die Einordnung eines Sprints in ein großes Ganzes durch die Sprintvision [3].
Was zunächst wie ein Spiel klingt, hat in der realen Welt durchaus Erfolg. Nach einer Einführung in Gamification und Scrum gehen wir in diesem Artikel auf verschiedene Gamification-Elemente ein und zeigen deren Einsatz im Scrum auf. Abschließend betrachten wir die Auswirkungen auf das Team sowie konkrete Ergebnisse.
Gamification
Gamification wird definiert als die Anwendung von Elementen des Game-Designs in einem spielfremden Kontext [4]. Dieser Kontext können unternehmerische Abläufe sein, Projektvorgehen oder eben auch Anwendungen wie komplexe Softwaresysteme. Ziel ist es, Mitarbeiter durch die Integration von spielerischen Elementen zu motivieren, ihr Engagement innerhalb der Abläufe zu erhöhen oder Anwendungen in ihrem beruflichen Kontext einzusetzen [5]. Dies wird momentan gern im internen Wissensmanagement von Unternehmen verwendet. Gamification nutzt dabei verschiedene Elemente – etwa die Bedienung einer Software oder schlicht die Beteiligung an verschiedenen Maßnahmen.
Der amerikanische Wissenschaftler für Gamification und Motivation, Yu-Kai Chou, entwickelte ein Framework, das den Elementen der Gamification acht Triebkräfte zuordnet [2]. Diese Triebkräfte stellen wir im Folgenden kurz vor, um dann aus der Menge möglicher Gamification-Elemente einzelne Beispiele vorzustellen, die für die Anwendung in Scrum prinzipiell in Frage kommen.
1. Epische Bedeutung & Berufung
Der Mensch muss erkennen, zu welchem Zweck er eine Aufgabe erfüllt. Er muss hinter seinem Handeln eine tiefere Bedeutung sehen, die sich nicht nur auf sein eigenes Leben auswirkt, sondern größer, weitreichender ist. Wenn er das Gefühl hat, von Bedeutung zu sein, wird er motiviert voranschreiten. Ein Element, um den Spieler abzuholen und seine Aufgabe in einen größeren Kontext zu stellen, ist ein erzählendes Intro. Es zeigt Spielern den übergreifenden Zweck des Spiels und versorgt sie mit einem intrinsischen Grund, das Spiel zu spielen.
Ein weiteres Element, um Spielern das Gefühl von Berufung zu vermitteln, ist Anfängerglück. Dabei erhalten Spieler zu Beginn durch eine glückliche Fügung ein wichtiges Item. So werden sie ermutigt, dieses Item sofort auszuprobieren. Ein Spieler könnte etwa Glück bei einem Kartenspiel haben und zu Beginn durch den Erhalt einer wertvollen Karte das Spiel gewinnen. Dieses positive Erlebnis wird den Spieler dazu motivieren, auf jeden Fall eine weitere Runde zu spielen.
2. Leistung & Entwicklung
Wer sich Herausforderungen stellt, kann an ihnen wachsen und sich weiterentwickeln. Das kann als zusätzliche Motivation dienen – wenn man den Fortschritt seiner Handlungen erkennt und sich der Aufgabe gewachsen fühlt. Punkte, Abzeichen und Rangfolgen sind hierbei wichtige Elemente, um Spielern Feedback zu geben – diese Belohnungselemente zeigen, dass sich die Spieler auf dem richtigen Weg befinden.
Fortschrittsanzeigen verdeutlichen somit nicht nur das bisher Erreichte, sondern können auch motivierend zeigen, dass bis zum Gewinn nur noch wenige Prozent fehlen. So wird bei LinkedIn dem Nutzer immer aufgezeigt, wie viel er noch ausfüllen oder unternehmen muss, bis sein Profil zu 100 Prozent vollständig ist – die Zahl, gepaart mit einer Bewertung wie "Superstar", sorgt für einen zusätzlichen Motivationsschub beim Nutzer.
3. Selbstbestimmung & Kreativität
Menschen möchten immer wieder neue Dinge ausprobieren und sich selbst entfalten. Der eigene freie Wille und die Möglichkeit, selbst Entscheidungen zu treffen, sorgen dabei für die Motivation des Einzelnen. Wirken sich diese Entscheidungen positiv aus, so fühlt man sich in seinem Handeln bestärkt – dafür ist jedoch Feedback essenziell.
Motivation durch Autonomie lässt sich auf vielen Wegen erreichen. Eine Möglichkeit ist die Wahl: Kann ein Spieler zwischen zwei Optionen wählen, so empfindet er sein Handeln als Konsequenz seines eigenen Willens, und nicht als externe Vorgabe. Dabei muss die gewählte Option nicht unbedingt besser geeignet sein, um das Spielziel zu erreichen. Wichtig ist lediglich die Möglichkeit der Wahl.
Um die Kreativität zu fördern, kann man dem Spieler neue Fähigkeiten zuweisen oder auch vorhandene verstärken. Ein Beispiel aus Jump 'n' Run-Spielen sind Power-Ups, die kurzfristig die Fähigkeiten einer Spielfigur modifizieren: schneller rennen, weiter springen oder auch teleportieren. In der Arbeitswelt erhalten Nutzer neue Fähigkeiten zum Beispiel durch neue Anwendungen oder neue Services, die in bestehenden Umgebungen wie Slack modular freigeschaltet werden können. So erhalten Spieler bzw. Nutzer einen Stimulus für ihre Kreativität und den Anstoß, produktiver zu arbeiten.
4. Eigentum & Identifikation
Menschen haben die Tendenz, sich auch mit unbelebten Dingen zu identifizieren. Es reicht oft aus, über etwas zu verfügen, und schon baut man eine Beziehung zu einem Ding auf. Diese Beziehung motiviert uns, den Besitz zu beschützen, zu pflegen und wenn möglich zu mehren, indem man weitere Dinger erwirbt.
Identifikation kann auch durch ein Zeit-Investment erreicht werden. Im Spielkontext etwa gibt es anpassbare Avatare und User Interfaces, die sich im Spielverlauf durch die Handlungen der Spieler verändern und weiterentwickeln. Wenn Spieler sich über längere Zeit hinweg der Gestaltung des Avatars widmen, so nehmen sie diesen als ihr Eigentum war und fühlen sich dafür verantwortlich.
5. Sozialer Einfluss & Beziehungen
Beziehungen zu anderen Menschen können ebenfalls motivierend wirken. Der Mensch als soziales Wesen definiert sich auch darüber, was ihm von anderen Menschen zurückgespiegelt wird – was andere über einen denken und wo andere im Vergleich zu einem selbst stehen, ist daher essenziell. Der Wettkampf mit anderen ist daher die Grundlage der meisten Spiele. Zudem kann der Zusammenschluss mit anderen Menschen synergetisch wirken und helfen, Problemstellungen besser und schneller zu bewältigen.
Ein Element, um soziale Dynamiken zu nutzen, sind sogenannte Group Quests – bekannt vor allem aus Rollenspielen. Dabei finden sich Spieler zusammen, um gemeinsam eine Aufgabe oder Queste zu bestreiten. Die Belohnung sind meist Verbesserungen an der eigenen Spielfigur in Form von verstärkten Eigenschaften oder Gegenständen sowie zuweilen andere, spielrelevante Items.
Um den eigenen sozialen Einfluss zu stärken, kann ein Mentoren-Element eingeführt werden. So können sich erfahrene Spieler als Mentor zur Verfügung zu stellen und andere Spieler unterstützen und anleiten. Spieler, denen geholfen wird, fühlen sich gut aufgenommen; Mentoren erfahren die positive Wirkung, gebraucht und geschätzt zu werden. Beiden Parteien gewinnen dabei – dies stärkt die sozialen Bindungen.
6. Unberechenbarkeit & Neugier
Unberechenbarkeit macht das Leben spannend. Ereignisse, die nicht ins momentane Denkmuster passen, regen unser Gehirn an; nicht zu wissen, was als nächstes passiert, erzeugt Spannung – und sorgt dafür, dass sich Menschen mit Dingen über längere Zeit beschäftigen.
Im Spiel kann dieses Element des Ungewissen ebenfalls eingesetzt werden. Eine Möglichkeit ist die sogenannte Mystery Box: eine unbekannte Belohnung für eine bestimmte Leistung. Hier ist nicht die Belohnung selbst das motivierende Element, sondern die Neugier. Unternehmen wie Mycouchbox [7] haben aus diesem Prinzip Geschäftsmodelle entwickelt und versenden monatlich an Abonnenten eine Box mit mysteriösem Inhalt.
7. Verlust & Vermeidung von Konsequenzen
Wir verlieren nicht gerne – weder Spiele noch Besitz. Die Reaktion auf drohenden Verlust ist daher eine zusätzliche Motivation, dieses Ding zu behalten oder auch die Verlustereignisse abzuwenden. Ein Beispiel ist das zeitlich befristete Angebot in einem Online-Shop. Haben wir das Angebot bereits öfter betrachtet und uns vorgestellt, das Angebotene zu besitzen, können diese Verlustängste greifen – und wir schlagen zu. So kann die Verlustmotivation in eine Kaufmotivation umgewandelt werden.
8. Mangel & Ungeduld
Ähnlich wie die Angst vor Verlust funktioniert die Habgier auf seltene Dinge. Weil wir wissen, dass der Bestand knapp ist und somit ein Mangel droht, steigt das Ding der Begierde im Wert. Dabei empfinden wir nicht nur Verknappung als attraktiven Mangel: auch wenn eine aufwändige Leistung erforderlich ist, um einen Gegenstand oder Zustand zu erreichen, begreifen wir dies oft als exklusiv und damit begehrenswert.
Ein bewährtes Element zur Anzeige von Mangel sind Countdown-Timer. Hier gilt der Zeitmangel als große Motivation, um vor Ablauf des Timers ein bestimmtes Ziel zu erreichen, das danach außer Reichweite ist. Kurz vor dem Ende können Gruppen und Individuen noch Kraftreserven mobilisieren, um in einem letzten Vorstoß die Aufgabe noch zu erfüllen.
Mit dem Mangel verwandt ist die Ungeduld. Wenn wir nicht mehr warten wollen, sind wir oft motiviert, Dinge sofort zu erledigen – auch wenn der Aufwand höher ist. Dies macht sich der Filehosting-Dienst Dropbox zunutze. Der Nutzer erhält zwei Optionen: er kann für mehr Speicherplatz entweder bezahlen oder aber Freunde als Nutzer anwerben. Nach den ersten Anstrengungen, Freunde anzuwerben, zahlen viele Nutzer jedoch den Beitrag – einfach, weil diese Option schneller ist.
Scrum
Viele der genannten Spiel-Elemente sind grundlegende Elemente unseres täglichen Lebens. Viele Motivatoren kennen wir auch vom Umgang mit Kindern. Neu dagegen ist die geplante Einführung solch motivierender Elemente am Arbeitsplatz. Interessanterweise weisen bereits einige Ideen und Best Practices im Scrum eben diese Elemente auf.
Scrum [6] ist ein etabliertes Framework für agiles Projektvorgehen, das mit seinen Rollen wie Product Owner, Scrum Master und Team, mit Events wie Planning, Daily, Sprint, Review und Retrospektive sowie mit seinen Artefakten wie Backlog, Definition of Done und Inkrement für schnelle, vorzeigbare Lösungen sorgt, die von einem sich selbst steuernden Team erzeugt werden.
Unabhängig von Scrum oder Gamification hat die Arbeit im Team und die Leistung als Team grundsätzlich eine motivierende Wirkung. Manche Aufgaben sind sogar so herausfordernd, dass sie nur in einem Team bewältigt werden können. Dabei fließen Fähigkeiten und Kenntnisse jedes Mitglieds ein und sorgen für Synergie-Effekte. In der Gamification-Sprache ist dies eine Group Quest, also eine Herausforderung für die Gruppe, Situationen gemeinsam zu meistern.
Auch die Autonomie des Teams findet sich sowohl in Scrum als auch in Gamification-Elementen wieder. Im Scrum bestimmt das Team selbst, wie viele User Stories es sich zur Umsetzung in einem Sprint vornimmt, wann welche Aufgaben erledigt werden und wer welche Aufgaben erledigt. Dahinter steckt die Wahlmöglichkeit (Gamification), die das Team durch Selbstbestimmung und Eigenverantwortung motiviert. Das Team befindet sich im Hinblick auf die erarbeiteten Story Points pro Sprint auf Qualitätsansprüche nur im Wettbewerb mit sich selbst und nicht etwa mit anderen Teams.
Story Points bestimmen den Wert einer Story. Das Burndown Chart zeigt die geleisteten und verbleibenden Story Points und wirkt so als Fortschrittsanzeige. Selbst die Ermittlung der Anzahl der Story Points zu einer Story erfolgt in Scrum spielerisch durch ein Planning Poker in der Diskussion im Gesamtteam. Die Geschwindigkeit des Teams wird als Velocity bezeichnet, die man als Durchschnitt über die Summe aller vom Team erledigten Story Points nach jedem Sprint berechnen kann.
Das Product Backlog stellt in Scrum das übergeordnete Ziel dar – die globale Story des Spiels. Sowohl das Product Backlog, als auch das Sprint Backlog können als Quest-Listen betrachtet werden: sie fassen alle Aufgaben zusammen, die noch zu erledigen sind. Das Sprint Backlog ist dabei kurzfristig als Level-Ziel, das Product Backlog als langfristiges Spielziel anzusehen. Für jeden Sprint wird eine Vision formuliert, die aktuelle Aufgaben in einen größeren Kontext einordnet; aus Gamification-Sicht wird damit epische Bedeutung aufgebaut.
Die oben genannten Scrum-Komponenten lassen sich also problemlos mit Gamification-Elementen identifizieren. Im nächsten Schritt möchten wir nun diese bereits eingesetzten Elemente erweitern. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man je nach Kontext des Scrum-Teams einsetzen kann.
Scrum + Gamification = Motivation
Erfahrungen im spielerischen Kontext
Eher positive Aspekte
- Der Countdown-Timer für die Sprint-Länge wurde am besten angenommen – nahezu alle Gruppen waren sich über die positive Wirkung dieses Gamification-Elements einig. Auch die Einbettung der Aufgabe in eine Handlung mit Alltagsbezug sorgte bei den Teilnehmern für ein positive Rückmeldung. Positiv bewerteten die Gruppen auch die Möglichkeit, Tools und Unterstützung in einem Shop erwerben zu können.
- Auch die Vergabe eines kostenlosen Tools wurde gut aufgenommen. Die zufällige Vergabe per Würfeln bewerteten die Gruppen jedoch unterschiedlich – eine ältere Teilnehmergruppe sah diesen Zufallsfaktor negativer als eine jüngere Gruppe.
- Im Gegensatz zum Scrum-Regelwerk wurde die Reihenfolge für die Bearbeitung der User Stories freigestellt und keine Prioritäten festgelegt. Dies kam bei den untersuchten Teilnehmergruppen sehr gut an.
Eher negative Aspekte
- Die Smarties und M&M’s in den Reagenzgläsern zeigten die Team-Velocity. Hier wurde bemängelt, dass die Velocity nur für das eigene Team sichtbar war – ein Vergleich der Teams jedoch fehlte. Vor allem die ältere Teilnehmergruppe bewertete dies negativ.
- Im Rahmen eines Workshops bearbeiteten verschiedene Teams die gleichen User Stories. Die Ergebnisse wurden präsentiert und mit Applaus bewertet. Diese Bewertung wurde negativ empfunden.
- Auch die Vergabe von Abzeichen wurde von beiden Teilnehmergruppen negativ bewertet. Der Erhalt einer unbekannten Belohnung durch den Erwerb dreier verschiedener Abzeichen jedoch wurde positiv aufgenommen.
- Die Möglichkeit, anderen Teams zu helfen und dafür eine Belohnung zu erhalten, wurde von den Teilnehmergruppen interessanterweise nicht positiv aufgenommen.
- Generell ließ sich beobachten, dass komplexe und umfangreiche Spielregeln die Teilnehmer oft überfordern. Daher sollten die neuen Spielregeln immer einfach und kurz gehalten werden.
Fazit und Ausblick
Richtig ist, was funktioniert.In laufenden Projekten ist es ratsam, nacheinander einzelne Elemente auszuprobieren und in einem Review zu evaluieren. Die plötzliche Einführung mehrerer Elemente ist kontraproduktiv – auch wenn die Idee dahinter ("Wir machen jetzt Gamification!") richtig sein mag. Erweisen sich einzelne Elemente als nicht effektiv, sollte man diese Elemente verwerfen und in einer anschließenden kreativen Phase die Integration von anderen Elementen prüfen. Richtig ist, was funktioniert. Die Betrachtung von Gamification im Kontext von Scrum steht erst am Anfang. Wir werden diesen Zusammenhang weiter vertiefen. Ein weiterer Ansatz wäre etwa die Evaluation, ob eine basisdemokratische Bewertung der Ergebnisse durch die Teilnehmer grundsätzlich als negativ empfunden wird – oder ob lediglich die Bewertung anhand der Applaus-Intensität ungeeignet ist. Eine ähnliche Argumentation lässt sich bei der negativ betrachteten Belohnung bei einer Hilfestellung finden. Es ist noch zu prüfen, ob die äußere Unterstützung im Allgemeinen als negativ empfunden wird oder vielmehr die Vergabe der Belohnung für die geleistete Unterstützung. Darüber hinaus werden in Zukunft weitere Untersuchungen in größeren IT-Softwareprojekten folgen, bei denen einzelne Gamification-Elemente gezielt in den laufenden Projekten eingesetzt und evaluiert werden sollen.
- Hamari, J: Flow in Gamification; University of Tampere; 2014;
- Chou, Y: Actionable Gamification – Beyond Points, Badges and Leaderboards; CreateSpace Independent Publishing Platform;14. 04.2015
- Corry, P.: Scrum and Motivation; 2013
- Deterding S. et al.: Gamification: Toward a Definition; Mindtrek Proceedings, ACM Press, Tampere; 2011;
- Kapp, K. M.: The Gamification of Training: Game-Based Methods and Strategies for Learning and Instruction; Pfeiffer & Co., John Wiley & Sons; San Francisco; 2012
- Pichler, R.: Scrum - Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzen; dpunkt.verlag; 2007, ISBN 978-3898644785
Informatik Aktuell: Roman Pichler – Agiles Produktmanagement mit SCRUM - Mycouchbox