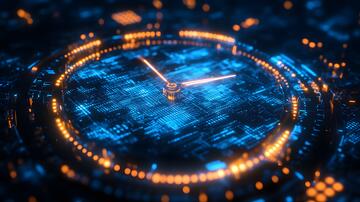Der Begriff "Plattform" ist hoffnungslos überstrapaziert!
DIE Landkarte für den digitalen Plattform-Dschungel

Der Begriff "Plattform" existiert schon sehr lange und wird extrem vielfältig verwendet, man muss leider schon sagen: Er wird "überstrapaziert". Wegen der Popularität großer Plattformen, dem Erfolg von Plattform-Unternehmen und den Verheißungen der Plattform-Ökonomie wird der Begriff inflationär gebraucht. Dadurch entsteht Verwirrung und selbst Experten in der IT-Industrie reden kontinuierlich aneinander vorbei.
Wir geben eine Landkarte durch den Plattform-Dschungel an die Hand, die es ermöglicht, verschiedene Arten von Plattformen zu erkennen und vor allem auch ihre unterschiedlichen Eigenschaften und Daseinsberechtigungen zu verstehen. Dadurch wird klar, wie groß die Unterschiede tatsächlich sind. Oft ist gar die einzige Gemeinsamkeit, dass Software im Spiel ist. Der Artikel hilft allen – egal in welcher Rolle in Business oder Technik – Missverständnisse in Zukunft zu vermeiden.

Der Begriff "Plattform" ist überstrapaziert – schon ohne IT-Bezug
Der Begriff "Plattform" existierte schon lange bevor es ihn in der IT gab. Bekannte Beispiele, die einem direkt in den Sinn kommen, sind die folgenden:
- Aussichtsplattform: ein exponierter Ort mit guter Aus- und Übersicht
- Ölbohrplattform: ein technisches Bauwerk, mithilfe dessen Öl auf hoher See gefördert und abtransportiert wird
- Plattform: ein Bahnsteig (eher aus dem Englischen adaptiert)
- Plattform: der begehbare Außenteil vorne und hinten an alten Eisenbahnwaggons
- Plattform: eine Bühne, auf der jemand spricht
- Plattform: eine gemeinsame technische Basis, auf der z. B. Fahrzeuge mit gemeinsamen Eigenschaften gebaut werden (z. B. die MEB-Plattform (Modularer E-Antriebs-Baukasten) von VW)
Wir sehen direkt, dass der Begriff ein breites Spektrum an Bedeutungen besitzt. Es ist kaum möglich, eine gut treffende, übergreifende Definition zu finden. Schon jenseits der IT-Welt ist der Begriff Plattform also überladen und überstrapaziert. Es kommt allerdings eher selten zu folgenschweren Verwechslungen der Begriffe, weil sich der Sinn häufig aus dem Kontext erschließt und die Begriffe insgesamt nur moderat häufig verwendet werden.
Der Begriff "Plattform" ist überstrapaziert – erst recht in der IT!
Die Häufigkeit, mit der man den Begriff und seine Zusammensetzungen antrifft, steigt sprunghaft an, wenn wir uns in die Welt der IT begeben. Jeder kann kurz innehalten und überlegen, was die eigenen Assoziationen mit dem Begriff "Plattform" sind.
Welche Plattform-Begriffe sind häufig anzutreffen?
In der IT und damit in der Welt der Software ist es bedeutend schwieriger, sich Plattformen konkret vorzustellen. Deshalb lässt sich auch keine Bildkomposition erstellen, die ähnlich plakativ die Arten von Plattformen sichtbar machen würde wie in Abb. 1. Weil es gleichzeitig aber noch viel mehr Plattform-Begriffe gibt, zeigen wir in Abb. 2 eine kleine Auswahl dieser Begriffe, wie wir alle sie häufig antreffen. Durch diese Übersicht wird direkt klar, dass es sehr leicht ist, sich mit jemanden über "Plattformen" zu unterhalten und dabei völlig aneinander vorbei zu reden.
Was sind Ursachen für das Wirrwarr der Plattform-Begriffe?
Gegen die Vielfalt der Plattformbegriffe ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Aus einem bestimmten Blickwinkel sind die Plattformbegriffe auch meist valide, werden aber leider nicht mit einem einheitlichen Verständnis verwendet.
Das Wirrwarr entsteht durch verschiedene sich überlagernde Effekte:
- Plattformbegriffe werden sowohl für konkrete Umsetzungen (z. B. Java-Plattform, iOS-Plattform) als auch für Kategorien (z. B. Technologie-Plattform) verwendet.
- Es werden Kategorienamen verwendet, die in die Irre führen können: Man trifft öfter auf die Unterscheidung Transaktionsplattformen vs. Innovationsplattformen [1;2]. Transaktionsplattformen werden in diesem Sinne als vermittelnde Dienste zwischen Anbietern und Konsumenten gesehen. So weit so gut. Innovationsplattformen werden als die technologische Basis gesehen, auf der andere Unternehmen ihre Angebote bauen können. Gerade weil Unternehmen wie Airbnb oder Uber als besonders innovativ mit ihren Geschäftsmodellen wahrgenommen werden, kommt es häufiger zu Verwechslungen.
- Oft wird verkürzend der abstrakteste Begriff "Plattform" verwendet, ohne weitere Spezialisierung. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Arten von Plattformen ist die Verwirrung vorprogrammiert, wenn der Begriff auf unterschiedliche Zuhörer mit ihrem unterschiedlichen Vorwissen trifft.
- Es wird oft nicht unterschieden, ob der Fokus der Betrachtung auf technischen oder auf geschäftlichen Aspekten liegt (bei der Betrachtung der Java-Plattform geht es meist um technische Aspekte, bei der Airbnb-Plattform fast immer um das dahinterliegende Geschäftsmodell). Letztlich sind fast immer beide Aspekte relevant, werden aber sehr unterschiedlich betont.
- Es wird oft verallgemeinert, um bestimmte Effekte noch plakativer darstellen zu können. So wird z. B. oft dargestellt, wie dominierend Plattform-Unternehmen in der Weltwirtschaft sind und wie dominant die Unternehmen aus den USA und Asien dabei sind [3;4]. Während diese grundsätzliche Aussage absolut richtig ist und der Handlungsbedarf in Deutschland und Europa gar nicht genug betont werden kann, geht trotzdem einiges durcheinander: Unter den größten Plattformen werden immer wieder Apple, Amazon, Facebook, Google und Microsoft genannt. Als Kontrastpunkt in Europa, weit abgeschlagen aber immer noch mit signifikanter Größe, wird z. B. SAP genannt. Auch wenn alle diese Unternehmen sehr finanzstark und erfolgreich sind und man sie gut mit dem Plattformbegriff in Bezug bringen kann, sind sie doch sehr unterschiedlich und machen teilweise sehr große Umsatzanteile außerhalb von Plattformgeschäftsmodellen:
- Amazon macht immer noch einen riesigen Umsatz mit dem Webshop, und zusätzlich im vermittelnden Sinne einer Plattform mit dem Marktplatz. Außerdem steigen die Umsätze mit der Cloud-Plattform AWS immer weiter.
- Apple bezieht seine Stärke aus der Kombination von Hardwaregeschäft und einem Ökosystem rund um Apps und Software, die passgenau und wohlintegriert auf der Technologie von Apple laufen.
- Facebook bezieht nahezu seinen kompletten Wert und Umsatz aus der Vernetzung von Menschen und Organisationen und entspricht damit sehr stark der Idee der Plattform-Ökonomie.
- Microsoft ist ganz anders ausgerichtet und verdient viel Geld mit seinen Softwareprodukten und der Cloud-Plattform Azure. Gleichzeitig ist der vernetzende und vermittelnde Charakter viel geringer.
- SAP ist im eigentlichen Sinne erst mal kein Plattform-Unternehmen sondern ein Anbieter von Unternehmenssoftware. Teilweise bietet SAP auch das Hosting in der Cloud, in kleinem Umfang stellt SAP auch einen Marktplatz für das Vermitteln von Zusatzsoftware an. Insgesamt betrachtet ist der Plattform-Charakter also viel schwächer ausgeprägt.
- Der Begriff "Plattform" ist einfach "hip" und "Hype". Keines der genannten Geschäftsmodelle ist per se besser oder schlechter und alle haben ihre vollste Berechtigung, egal wie groß der Anteil welcher Arten von Plattformen ist. Wir beobachten aber die Tendenz, dass teils absichtlich aus Marketinggründen, teils unwissentlich alles als "Plattform" bezeichnet wird, was im Entferntesten etwas mit Software zu tun hat. Plakative Aussagen wie "Why platforms beat products every time" verstärken diesen Drang, weil alle bei ihrem Management und ihren Kunden als innovativ und zukunftsfähig wahrgenommen werden wollen [5].
Warum ist das Wirrwarr der Plattform-Begriffe problematisch und gefährlich?
Wir haben in der Praxis alle folgend gesammelten Probleme beobachtet und möchten mit der Landkarte dazu beitragen, diese zu verhindern:
- Missverständnisse führen zu Ineffizienz und verfehlten Zielen: Leute im eigenen Unternehmen reden kontinuierlich aneinander vorbei, weil ihnen ein gemeinsames Verständnis und klare Begriffe fehlen. Das kann einerseits zu direkten Konflikten führen, weil Missverständnisse nicht auflösbar sind. Andererseits kann es zu noch größeren Problemen führen, weil sich alle gegenseitig Recht geben und denken, das Gleiche zu meinen und trotzdem arbeiten alle ohne gemeinsames Verständnis vom Ziel. Die Resultate reichen von "die falschen Leute wurden eingestellt" über "die falsche Software wurde gebaut" bis hin zu "es wurde massiv viel Geld verschwendet" und "man ist nach Jahren kein Stück weitergekommen".
- Missverständnisse führen zu enttäuschten Kunden: Gerade die Diskussion über Unternehmensgrenzen hinweg ist noch stärker von Missverständnissen bedroht. Oft werden die Vorteile der angebotenen Plattform in schillernden Farben erzählt und auf der Gegenseite erwartet man sich von einer Plattform den ganz großen Wurf. Das Resultat ist oft große Enttäuschung.
- Nicht verstandene Vorbilder führen zu falschen Zielen: Man hört immer wieder, dass Plattform-Ökonomie das überlegene Geschäftsmodell ist und fasst sich ein Herz, auch in diese Richtung zu gehen. Weil man aber die Prinzipien nicht richtig verstanden hat, kommt man nicht zu einem klaren Geschäftsmodell, das die Mächtigkeit der Plattformökonomie wirklich nutzen könnte. Der Bau einer Plattform verkommt damit leicht zum Selbstzweck.
- Übermächtige Vorbilder führen zu überambitionierten Zielen: Weil die Leuchttürme der Plattformökonomie oft verschiedene Aspekte von Plattformen in sehr geschickter Weise verknüpfen, setzt man sich ebenfalls sehr große Ziele. Diese sind oft überambitioniert und folgen keinem klaren Plan des Aufbaus. Insbesondere wird gerne vernachlässigt, dass die Vorbilder oft gut und gerne ein bis zwei Jahrzehnte Aufbauarbeit geleistet haben und dann erst Früchte tragen.
Die Landkarte für den Plattform-Dschungel
Um die beschriebenen Probleme mit Plattformen zu vermeiden, stellen wir eine Landkarte vor, die die Plattform-Begriffe einordnet. Dabei setzen wir mehr darauf, die Orientierung durch Bezüge und Abgrenzung der Begriffe zu erreichen und weniger auf besonders elaborierte und ausführliche Definitionen. Alle Begriffe untermauern wir mit passenden und bekannten Beispielen. Die Landkarte bauen wir schrittweise auf. Noch mehr Infos zur Verwendung der Landkarte finden sich unten.
Was ist eine Plattform?
Der Begriff Plattform ist in der IT weit verbreitet und wird in vielfältigen Bedeutungen verwendet. Mit einem eher ökonomischen Blick bezeichnen Plattformen voll digital abgebildete Geschäftsmodelle in mehrseitigen Märkten, die besonders wegen ihrer Netzwerkeffekte erfolgreich sind. Mit einem eher technischen Blick bezeichnen Plattformen Softwarebestandteile, die wiederkehrende technologische und infrastrukturelle Aspekte von Software-Systemen lösen und durch möglichst klar definierte Schnittstellen verwendet werden. Die zentrale Gemeinsamkeit von verschiedensten Arten von Plattformen ist, dass sie etwas anbieten, auf dem etwas Höherwertiges aufgebaut werden kann.
Die erste und wichtigste Unterscheidung von Plattformen ist die in Technologie-Plattformen und Ökosystem-Plattformen. In aller Kürze kontrastiert:
- Technologie-Plattformen bilden eine technische Grundlage, um Software zu entwickeln und zu betreiben. Dabei entstehen keine Netzwerkeffekte und man spricht nicht von Plattform-Ökonomie.
- Ökosystem-Plattformen hingegen sind das technische Mittel für die Vermittlung jeglicher Art von Assets in einem mehrseitigen Markt und führen zu den gewünschten Netzwerkeffekten der Plattformökonomie [6;7;8].
Was ist eine Technologie-Plattform?
Technologie-Plattformen werden dazu verwendet, Software (Dienste, Applikationen, weitere Technologie-Plattformen) darauf zu bauen und zu betreiben. Technologie-Plattformen kapseln wiederkehrende technologische und infrastrukturelle Aspekte von Software-Systemen und machen diese möglichst einfach durch klar definierte Schnittstellen verwendbar. Entwickler wählen Technologie-Plattformen aus, um darauf die von ihnen entwickelte Software zu bauen und zu betreiben. Dadurch werden die Entwickler von vielen Basisthemen entlastet und können sich stärker auf die eigentliche Applikationslogik fokussieren, die sie entwickeln möchten.
Technologie-Plattformen sind meist für die Endanwender von Software weniger relevant und viele Technologie-Plattformen sind nicht sichtbar, sondern agieren nur im Hintergrund. Sie werden typischerweise von einer Organisation entwickelt (die damit üblicherweise ihr Geld verdient) und von einer anderen Organisation verwendet (die für die Technologie-Plattform Geld bezahlt und ihr Geld mit der darauf aufgebauten Software verdient). In sehr großen Unternehmen können Technologie-Plattformen auch organisationsintern von einer Einheit entwickelt werden und von anderen Einheiten verwendet werden (s. Platform Engineering).
Technologie-Plattformen führen nicht zu den klassischen Netzwerkeffekten, es gibt auch keine mehrseitigen Märkte. Deshalb zählen Technologie-Plattformen nicht zur sogenannten Plattformökonomie. Die ursprüngliche Verwendung des Begriffs Plattform in der Informatik war im Sinne von Technologie-Plattform und existiert schon seit Jahrzehnten. Der oben genannte Begriff "Innovationsplattform" entspricht grob einer Technologie-Plattform.
In Abb. 3 sind verschiedene Typen von Technologie-Plattformen und zugehörige Beispiele (in Türkis) eingeordnet. Die Landkarte ist so aufgebaut, dass am unteren Ende die Hardware positioniert ist, auf der die entwickelte Software betrieben werden soll. Darüber kann es verschiedene Stufen von Technologie-Plattformen geben, die immer wieder aufeinander aufbauen. Eine weitere explizite Unterscheidung machen wir in der Landkarte: wo und durch wen die Technologie-Plattform betrieben wird – dabei ist die Hauptunterscheidung, ob der Betrieb der Technologie-Plattform von außerhalb eingekauft wird (as a Service, Cloud-Computing) oder nicht.
Hardware Platform: Eine Technologie-Plattform auf Hardware-Ebene, die als Grundlage für Entwicklung und Betrieb von Software dient, z. B. die Intel x64 Platform.
IaaS Platform (Infrastructure-as-a-Service): Eine Hardware-Plattform, die von einer anderen Organisation bereitgestellt und betrieben wird (as a Service), z. B. AWS IaaS oder Azure IaaS. Konkret versteht man darunter insbesondere Rechen-Infrastruktur (virtuelle Server) und Speicher-Infrastruktur, darüber hinaus auch Netzwerk-Infrastruktur.
Operating System Platform: Eine Technologie-Plattform, die die grundlegende Softwareschicht über der Hardware eines Systems bildet, z. B. Microsoft Windows oder Linux. Sie verwaltet die Hardware und ermöglicht den standardisierten Zugriff darauf.
Runtime Environment Platform: Eine Technologie-Plattform, die auf einer Operating System Platform aufsetzt und weitergehende Features und Dienste im Sinne des Managements und der Ausführung von Softwaresystemen anbietet, z. B. Java (Runtime Environment), .NET, Cloud Foundry.
PaaS Platform (Platform-as-a-Service): Eine Runtime Environment Platform, die von einer anderen Organisation bereitgestellt und betrieben wird (as a Service), z. B. AWS PaaS oder Azure PaaS. Konkret können sich dahinter sehr viele unterschiedliche Dienste verbergen, wie gemanagte Speichersysteme, Load Balancer, Ausführungscontainer für Komponenten, Services, Functions.
Runtime Environment Platform bzw. PaaS Platform with Business Logic: Eine Runtime Environment Platform, die sich nicht auf Infrastruktur-Aspekte beschränkt, sondern für bestimmte Anwendungsbereiche auch Geschäftslogik in standardisierter Weise mitbringt. Auf diese Plattformen können Entwickler aufsetzen, wenn sie Unternehmenssoftware bauen. Salesforces PaaS ist hierfür ein Beispiel.
Technologie-Plattformen bringen nur dann einen Nutzen, wenn Softwaresysteme auf ihnen aufgebaut werden. Auch das ist in Abb. 3 durch die Beispiel-Applikationen Word und Slack abgebildet. Entwickler haben die Auswahl, welche Technologie-Plattformen sie einsetzen, um ihre Software zu entwickeln und zu betreiben. Dabei kann es auch sein, dass sie sich für ein ganzes Bündel von Technologie-Plattformen entscheiden, um die Grundlage für ihre Applikation zu legen. Damit treffen sie auch Entscheidungen über den späteren Betrieb, für welche Kunden eine Applikation geeignet ist (z. B. Kunden mit Windows-Rechner vs. Kunden mit Apple-Rechner) und welche Art von Geschäftsmodellen möglich ist (z. B. Einmalkauf vs. monatliche Subskriptionskosten). Für die Endanwender bleiben so manche Entscheidungen für Technologie-Plattformen komplett unsichtbar und manche wirken sich direkt aus.
Was ist Platform Engineering?
Platform Engineering: Die Engineering-Disziplin, eine Technologie-Plattform in einem Unternehmen für die eigene Verwendung zu bauen und daraufhin zu optimieren, dass andere Teams möglichst effizient und schnell die eigentlichen Softwaresysteme für das Business des Unternehmens bauen können.
Eine gebräuchliche Definition von Plattform in diesem Sinne stammt von Evan Bottcher [9]: "Eine digitale Plattform ist ein Fundament von Selbstbedienungs-APIs, Werkzeugen, Diensten, Wissen und Support, die als überzeugendes internes Produkt gestaltet sind. Autonome Lieferteams können die Plattform nutzen, um Produktfunktionen in einem höheren Tempo und mit weniger Koordination zu liefern." In diesem Zusammenhang kommt oft der Begriff "Team Topologies" [10] zum Einsatz, der unterschiedliche Konstellationen von Teams und deren Zusammenwirken innerhalb eines Unternehmens beleuchtet. Es handelt sich hier ganz klar um Technologie-Plattformen, auch wenn der Begriff meist nicht so spezifisch gewählt wird, sondern allgemein von Plattformen gesprochen wird.
Platform Engineering als Disziplin ist in den letzten Jahren in aller Munde, weil große Unternehmen damit Vorteile beim Entwicklungstempo realisieren konnten. Wie so oft wurde dafür der unspezifische Begriff "Platform" verwendet, der zwar in einer engeren Community halbwegs gut verstanden ist, darüber hinaus aber ständig für Verwechslungen sorgt.
Was ist eine Digitale-Ökosystem-Plattform?
Digitale Ökosysteme wie Netflix, Airbnb oder Uber und ihre Digitalen-Ökosystem-Plattformen haben ihre jeweilige Branche schon stark verändert. "Ein Digitales Ökosystem ist ein sozio-technisches System, in dem Unternehmen und Menschen kooperieren, die zwar unabhängig sind, sich von der Teilnahme aber einen gegenseitigen Vorteil versprechen. Ein Digitales Ökosystem hat in seinem Zentrum eine digitale Plattform, die diese Kooperation über Ökosystem-Dienste besonders gut unterstützt. … Der Gesamtnutzen eines Digitalen Ökosystems ergibt sich somit aus der Kombination der digitalen, vermittelnden Plattform und einer großen Menge an Partnern, die zum gegenseitigen Nutzen am Digitalen Ökosystem teilnehmen und durch ihre Interaktionen über die Plattform zu Netzwerkeffekten führen." [6]
Digitale-Ökosystem-Plattform (verkürzt auch: Digitale Plattform): Ein Softwaresystem, das den technischen Kern eines Digitalen Ökosystems bildet, das von Anbietern und Konsumenten über APIs oder Benutzungsoberflächen direkt genutzt wird und die Interaktion zwischen Anbietern und Konsumenten innerhalb eines Digitalen-Ökosystem-Services ermöglicht [7;8].
Digitale-Ökosystem-Plattformen bilden also das Herzstück eines jeden Digitalen Ökosystems und ermöglichen es, die vermittelnde Leistung des Brokers im Digitalen Ökosystem rein digital und damit skalierbar und effizient durchzuführen. Damit bilden sie die technische Grundlage des Geschäftsmodells eines Digitalen Ökosystems. Die Digitale-Ökosystem-Plattform macht es allen Beteiligten idealerweise so einfach wie möglich, beizutreten und an der Vermittlung von Assets teilzunehmen. Die Netzwerkeffekte, die entstehen, wenn viele Beteiligte in einem solchen mehrseitigen Markt interagieren, machen Digitale Ökosysteme so interessant und lukrativ. Daher sind erfolgreiche Digitale Ökosysteme ein Vorbild und Zielbild in der Digitalen Transformation zahlreicher Branchen. Der oben referenzierte Begriff "Transaktionsplattform" entspricht grob einer Digitalen-Ökosystem-Plattform.
Digitale-Ökosystem-Plattformen stehen zu Technologie-Plattformen insofern in Bezug, dass sie meist auf PaaS-Plattformen realisiert werden, die ein sehr schnelles Wachstum der Last und die Anpassung an steigende Nutzungszahlen erlauben.
Auch bei den Digitalen-Ökosystem-Plattformen lassen sich Unterkategorien unterscheiden (s. Abb. 4). Unsere Kategorien lehnen sich hier an einen Ausschnitt aus [11] an. Während die verschiedenen Kategorien von Digitalen-Ökosystem-Plattformen die oben genannten Gemeinsamkeiten haben, gibt es Unterschiede in Bezug auf die spezifische Rolle der Provider und Consumer, die vermittelten Assets und die Art und Konditionen der Anbahnung und Abwicklung der Vermittlung. Die Kategorien sind nicht komplett trennscharf und es könnte auch weitere Ausprägungen geben. Anders als bei den Technologie-Plattformen hat die Anordnung hier keine Bedeutung in dem Sinne, dass Plattform-Typen aufeinander aufbauen würden.
Marketplace Platform: Eine Digitale-Ökosystem-Plattform, die im Sinne eines Marktplatzes Anbieter und Konsumenten verbindet (z. B. Airbnb, Ebay, Amazon Marketplace). Die Preise der gehandelten Assets werden (meist) durch die Anbieter festgelegt. Eine große Anzahl an Anbietern und Konsumenten führt zu den verstärkenden Netzwerkeffekten und zur Attraktivität des Marktplatzes. Die Identität der Anbieter ist weniger relevant, es geht mehr um die gehandelten Assets, die auch von verschiedenen Anbietern konkurrierend angeboten werden können.
On-Demand Service Platform: Eine Digitale-Ökosystem-Plattform, über die Services mit passender Qualität für Konsumenten angeboten werden und die den kompletten Prozess von der Suche über die Bestellung und die Ausführung abdecken (z. B. Uber). Im Vergleich zum Marktplatz wird die Servicequalität und der Preis durch die Plattform festgelegt und das Ziel ist es, möglichst hohe und gleichmäßige Verfügbarkeit zu gewährleisten, was nur bei einer großen Zahl von Konsumenten und Anbietern möglich ist. Der Konsument sucht sich keinen Anbieter aus, sondern bucht den Service und ein Anbieter wird dann durch die Plattform zugeteilt.
Communication/Interaction Platform: Eine Digitale-Ökosystem-Plattform, deren Hauptdienst es ist, Menschen oder Organisationen miteinander in Austausch zu bringen (z. B. Facebook, Whatsapp, Snapchat, Tinder, Parship). Die vermittelten Assets sind so die Nachrichten bzw. Interaktionen mit anderen Teilnehmern des Ökosystems. Bei den Teilnehmern ist hier vor allem die Identität wichtig, weil meist eine Interaktion zwischen bestimmten Menschen über die Plattform stattfinden soll. Eine solche Plattform ist für Menschen meist vor allem dann interessant, wenn viele bekannte bzw. interessante Personen auch Teil des Digitalen Ökosystems sind.
Data Harvesting Platform: Eine Digitale-Ökosystem-Plattform, die ihren Nutzern eine Dienstleistung anbietet, bei deren Nutzung kontinuierlich Daten gesammelt werden, um die Dienstleistung zu verbessern (z. B. Waze). Nutzer stimmen explizit dieser Datensammlung und -verwendung zu. Die Daten werden nicht direkt zwischen den Nutzern vermittelt, das passiert nur indirekt durch die Verbesserung des Services. Dieses Prinzip ist auch mit anderen Formen von Digitalen-Ökosystem-Plattformen kombinierbar.
Content Crowdsourcing Platform: Eine Digitale-Ökosystem-Plattform, die eine große Menge von Menschen als Anbieter und Konsumenten miteinander verbindet (z. B. Wikipedia, YouTube). Das zentrale Asset, das vermittelt wird, ist eine bestimmte Art von Content, es kann sich sehr abstrakt um Texte, Videos oder Musik handeln, genauso aber auch um sehr spezifische fachliche Inhalte. Diese Plattformen sind in der Regel Consumer-to-Consumer (C2C).
Content Distribution Platform: Eine Digitale-Ökosystem-Plattform, die eine Verbindung zwischen Anbietern von Online-Angeboten (mit vielen Nutzern) und den Anbietern von bestimmten auszuspielenden Inhalten herstellen (z. B. Google AdSense, verbindet Werbetreibende mit Webseiten-Betreibern). Somit erlaubt es die Plattform den Anbietern der Inhalte, direkt und zielgerichtet viele Ausspielmöglichkeiten zu identifizieren und zu bedienen. Das gesamte Digitale Ökosystem umfasst dann auch die Endnutzer, die die ausgespielten Inhalte zu sehen bekommen. Diese Plattformen sind in der Regel Business-to-Consumer (B2C).
Was ist eine Digitale Plattform?
Digitale Plattform ist der abgekürzte Name für Digitale-Ökosystem-Plattform und wird in der Praxis häufig verwendet. Eine Digitale Plattform ist ein Softwaresystem, das den technischen Kern eines Digitalen Ökosystems bildet, das von Anbietern und Konsumenten über APIs oder Benutzungsoberflächen direkt genutzt wird und die Interaktion zwischen Anbietern und Konsumenten innerhalb eines Digitalen-Ökosystem-Services ermöglicht.
Was ist Plattformökonomie?
Plattformökonomie (Platform Economy) ist ein ökonomisches Prinzip, das auf den Wirkprinzipien Digitaler Ökosysteme und ihrer Digitalen-Ökosystem-Plattformen aufbaut (insbesondere Netzwerkeffekte [12]) und ein eindeutiges ökonomisches Interesse der Ökosystem-Teilnehmer zugrunde legt.
Platform Economy Platform: Eine Digitale-Ökosystem-Plattform nach den Prinzipien der Plattformökonomie (also mit ökonomischen Interessen). Deshalb sehen wir YouTube in dieser Kategorie und Wikipedia aber nicht.
Mit den Technologie-Plattformen und Digitalen-Ökosystem-Plattformen haben wir zentrale Kategorien von Plattformen eingeführt. Es gibt jedoch noch zahlreiche weitere Plattform-Begriffe, die oft querschnittlichen und kombinierenden Charakter haben. Diese ergänzen wir im Folgenden.
Was ist eine Software-Ökosystem-Plattform?
Eine Software-Ökosystem-Plattform kombiniert die Prinzipien von Technologie-Plattformen und Ökosystem-Plattformen (s. Abb. 5). Das bedeutet, dass eine Technologie-Plattform angeboten wird, auf der Software erstellt werden kann, die dann über einen Marktplatz an eine große Zahl von Konsumenten als Asset vermittelt wird. Beispiele: Das App-Ökosystem von Apple iOS ist die Technologie-Plattform und der Apple App Store ist der Marktplatz für die Apps. Genauso funktioniert es bei Android mit dem Google Playstore, bei Eclipse mit den Plugins oder bei Chrome mit den Plugins. Somit entsteht ein integriertes System, das die Entwicklung, Verteilung, Bezahlung und Nutzung von Software zum Vorteil des Ökosystem-Betreibers, der Software-Anbieter und der Nutzer unterstützt.
Was ist eine Cloud-Plattform?
Bisher hatten wir IaaS- und PaaS-Plattformen eingeführt. Recht häufig trifft man auch auf den Begriff "SaaS Platform".
Eine "SaaS Platform" ist eine in der Cloud betriebene Softwarelösung (Software as a Service), z. B. Salesforce oder Slack. Weil dieser Begriff keinem der typischen Plattformbegriffe und Kriterien entspricht, setzen wir ihn in Anführungszeichen. Weil er so häufig verwendet wird, ist er trotzdem Teil der Landkarte.
Cloud Platform: Ist ein Überbegriff für Plattformen, die als Cloud-Service betrieben und angeboten werden. Wir umfassen damit IaaS-, PaaS- und "SaaS-Plattformen". So sind Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure oder die Google Cloud Platform (GCP) sehr bekannte Beispiele.
Im Folgenden zoomen wir aus der bisherigen Darstellung heraus (s. Abb. 7). Die Plattform-Begriffe auf der linken Seite haben gemeinsam, dass sie keine komplett neue Art von Plattformen einführen, sondern die bisherigen Arten von Plattformen konkret ausprägen und auch kombinieren. Deshalb verwenden wir hier den Übergriff Mix-Plattformen. Weil diese Begriffe auch immer wieder auftreten, ordnen wir sie hier auch in der Landkarte ein. Die Leseweise ist so, dass eine konkrete Ausprägung (z. B. die Apple Platform) grundsätzlich alle Bereiche umfassen könnte, aber nicht muss. Das bedeutet, dass man für jede konkrete Plattform genau einordnen muss, welche Arten von Plattformen umfasst werden, um ihre Wirkweise komplett zu verstehen. Die Begriffe sind jeweils auch noch mal stark überladen und werden verallgemeinernd für sehr unterschiedliche Plattformen verwendet.
Was ist eine Hersteller-Plattform?
Als Hersteller-Plattform/Vendor Platform wird die Gesamtheit aller Produkte (Software-Lösungen, Dienste, teils auch Hardware) eines Herstellers bezeichnet, die besonders gut aufeinander abgestimmt und miteinander integriert sind (z. B. die Apple Plattform mit den verschiedenen Apple-Hardware-Produktlinien, den Apple-Betriebssystemen und den Applikationen von Apple, bis hin zum App Store). Darunter können auch Bestandteile fallen, die bisher überhaupt nicht in unseren Plattform-Begriffen aufgetaucht sind. Man findet hier auch häufiger den Begriff eines Hersteller-Ökosystems, das meist synonym verwendet wird.
Was ist eine Branchen-Plattform?
Als Branchen-Plattform/Domain Platform wird ein Paket von Produkten (Software-Lösungen, Dienste, teils auch Hardware) eines Herstellers bezeichnet, die ganz spezifisch für eine bestimmte Branche vorgesehen sind (z. B. Philips HealthSuite). Problematisch ist, dass Branchen-Plattformen, z. B. in der Branche Medizin, häufig in dem was sie abdecken und bieten sehr unterschiedlich sind. Weil die Begriffe Medizin-Plattform, Health Platform oder Health Data Platform aber sehr gerne verwendet werden, kommt es so kontinuierlich zu Missverständnissen.
Was ist eine Daten-Plattform?
Als Daten-Plattform/Data Platform wird ein Bundle von Produkten (Software-Lösungen, Technologie-Plattformen, Digitale-Ökosystem-Plattformen, …) bezeichnet, das einen besonderen Fokus auf der Sammlung, Verarbeitung, Verbreitung, … von Daten hat (z. B. Cloudera). Die Ausgestaltung und Fokussierung ist auch hier wieder sehr heterogen und reicht von Technologien zum Aufbau von Big-Data-Analysen bis hin zum unternehmensübergreifenden Austausch von Daten entlang von Zulieferketten.
Was ist eine IoT-Plattform?
Als IoT-Plattform wird ein Bundle von Produkten (Software-Lösungen, Technologien-Plattformen, Digitale-Ökosystem-Plattformen, teils auch Hardware, …) bezeichnet, das einen besonderen Fokus auf die Vernetzung von Dingen aus der realen Welt und ihre Integration in übergreifende Dienste hat (z. B. Siemens Mindsphere). Die Ausgestaltung und Fokussierung ist auch hier wieder sehr heterogen und reicht von Technologien zur einfachen Anbindung von Sensoren bis hin zu Ökosystem-Plattformen, die unternehmensübergreifend Sensordaten für die Verwendung in Geschäftsprozessen teilen.
Was ist eine Metaverse-Plattform?
Als Metaverse-Plattform wird ein Bundle von Produkten (Software-Lösungen, Technologien-Plattformen, Digitale Ökosystem-Plattformen, teils auch Hardware, …) bezeichnet, das einen besonderen Fokus auf immersive Welten und die Interaktion von Menschen in diesen Welten hat (z. B. Decentraland, Roblox). Begrifflich ist schon der Begriff Metaverse schwer zu greifen und befindet sich aktuell noch sehr in der Formung. Weil gleichzeitig ein ziemlicher Hype entstanden ist, wird aktuell der Begriff Metaverse-Plattform extrem willig und fast schon fahrlässig verwendet. Häufige Bestandteile sind Technologie-Plattformen für die Virtual-Reality-Interaktion, Technologie-Plattformen zur Erweiterung mit Applikationen und Ökosystem-Plattformen zur Interaktion mit anderen Nutzern.
Was ist eine "Allianz-Plattform"?
Als "Allianz-Plattform" bezeichnen wir einen Zusammenschluss von Organisationen und Menschen, die sich zu einem bestimmten fachlichen Thema austauschen und gemeinsam das Thema vorantreiben möchten. Beispiele sind die "Plattform Industrie 4.0" und die "Plattform lernende Systeme". Im eigentlichen Sinne sind Allianz-Plattformen keine Plattformen. Da der Plattform-Begriff aber in dieser Art verwendet wird, haben wir den Begriff Allianz-Plattform dafür etabliert und in der Landkarte eingeordnet.
Übergeordnet führen wir hier den Begriff "Pseudo-Plattformen" ein, um auch noch andere weiter gefasste Bedeutungen von Plattform verorten zu können.
Was ist eine Open-Source-Plattform?
Als Open-Source-Plattform bezeichnen wir querschnittlich alle Plattformen, bei denen die Software unter einer Open-Source-Lizenz steht. Das ist insbesondere bei Technologie-Plattformen der Fall (z. B. Linux als Operating System Platform).
Abb. 8 zeigt die vollständig aufgebaute Landkarte und fasst die einzelnen Bereiche noch mal mit griffigen Namen zusammen, damit man sich die Landkarte besser als Ganzes einprägen kann.
Ab jetzt zielsicher durch den Plattform-Dschungel
Wie ist die Plattform-Landkarte zu verstehen und zu verwenden?
Big Picture schlägt Präzisionsdefinitionen: Unsere Plattform-Landkarte ist ein Angebot an alle, die gerne mehr Überblick im Thema Plattformen hätten. Sie hat nicht den Anspruch, die einzige Wahrheit an Begriffen darzustellen. Man könnte mit Sicherheit auch andere Strukturierungen und Begriffe verwenden. Wichtig ist uns jedoch, dass alles zueinander passt und sich die Gesamtlandschaft dessen, was aktuell unter Plattformen verstanden wird, als Big Picture gut abgebildet werden kann und auch erweiterbar ist. Zugunsten dessen haben wir darauf verzichtet, für jeden Begriff möglichst präzise Definitionen zu liefern, die jeder wissenschaftlichen Diskussion standhalten.
Strukturierung von Diskussionen schlägt Kompendium zu Plattformen: Uns ist es wichtig, dass die Plattform-Landkarte von möglichst vielen Menschen und Rollen verstanden und eingesetzt wird. Dazu wählen wir eine kompakte Darstellung und auch Vereinfachungen. Damit ist sie weder ein Kompendium über Business Modelle rund um Plattformen noch bietet sie technische Tiefe. Für beides gibt es weiterführende Literatur. Wir möchten erreichen, dass Diskussionen möglichst zielführend verlaufen und Leute mit unterschiedlich viel Vorwissen und unterschiedlich ausgeprägtem Vorwissen einen gemeinsamen Nenner finden.
Unterstützung der Zielfindung schlägt detailliertes Design: Unsere Plattform-Landkarte soll dabei unterstützen, dass Unternehmen und Menschen passende und realistische Ziele für ihre Plattform festlegen und diese so gut diskutieren können, dass sie von allen beteiligten Personen verstanden werden. Es geht uns nicht darum, detaillierte Design Guidelines im Sinne von Business-Modellen oder der technischen Architektur zu geben.
Was sollte man sich auf jeden Fall zu Plattformen merken?
- Der Begriff "Plattform" und seine Ausprägungen ist stark überstrapaziert und das führt in der Praxis häufig zu Problemen. Daher empfehlen wir, nie nur über "Plattformen" zu sprechen, sondern immer eine differenzierte Bezeichnung zu verwenden, z. B. von unserer Landkarte.
- Um Missverständnisse zu vermeiden, braucht es eine klare Übersicht und ein gemeinsames Verständnis. Genau das wollen wir mit diesem Artikel bieten.
- Plattformen existieren in sehr unterschiedlicher Ausprägung und diese Ausprägungen haben ihre Berechtigung.
- Zentrale Kategorien von Plattformen sind Technologie-Plattformen und Digitale-Ökosystem-Plattformen. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Arten von Mix-Plattformen und mit SaaS-Plattformen und Pseudo-Plattformen auch welche, bei denen der Begriff entlehnt wurde, die aber im eigentlichen Sinne etwas anderes sind.
- Wenn man über Plattformen nachdenkt, dann sollte man immer verschiedene Perspektiven betrachten: geschäftliche Perspektive, technische Perspektive, rechtliche Perspektive.
- Wenn man selbst eine Plattform aufbauen möchte, sollte man die Ziele sehr klar definieren und sich gerne vom Erfolg anderer Plattformen inspirieren lassen, sich aber auch nicht blenden lassen.
- Wenn man selbst eine Plattform aufbauen möchte, sollte man auf keinen Fall zunächst sehr tief und ausschließlich die technische Perspektive verfolgen.
- Wir sollten in Deutschland und Europa den Mut und die Ausdauer haben, Plattformen und die dahinterstehenden Unternehmen aufzubauen und das Feld nicht den Tech-Giganten (die auch einen langen Atem brauchten!) allein überlassen!
- Wikipedia: Plattform-Unternehmen
- P.C. Evans, A. Gawer: The Rise of the Platform Enterprise – A Global Survey
- G. Gressler: Verschlafen deutsche Unternehmen gerade einen Trend?
- Platform Economy Blog: Wert der Top-100 Plattformen steigt auf 15,5 Billionen Dollar
- MIT Management Executive Education Blog: Why platforms beat products every time
- Fraunhofer IESE: Digitale Ökosysteme und digitale Plattformen – Made in Germany
- M. Trapp, M. Naab, D. Rost, C. Nass, M. Koch, B. Rauch: Digitale Ökosysteme und Plattformökonomie: Was ist das und was sind die Chancen?
- Fraunhofer IESE: Digitale Ökosysteme in Deutschland – Inspirierende Beispiele zur Stärkung der deutschen Wirtschaft
- E. Bottcher: What I Talk About When I Talk About Platforms
- Team Topologies - Organizing business and technology teams for fast flow
- Platform Hunt: The 9 Types of Software Platforms
- G. G. Parker, M. W. Van Alstyne, S. P. Choudary: Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy – and How to Make Them Work for You. W. W. Norton & Company, 2016